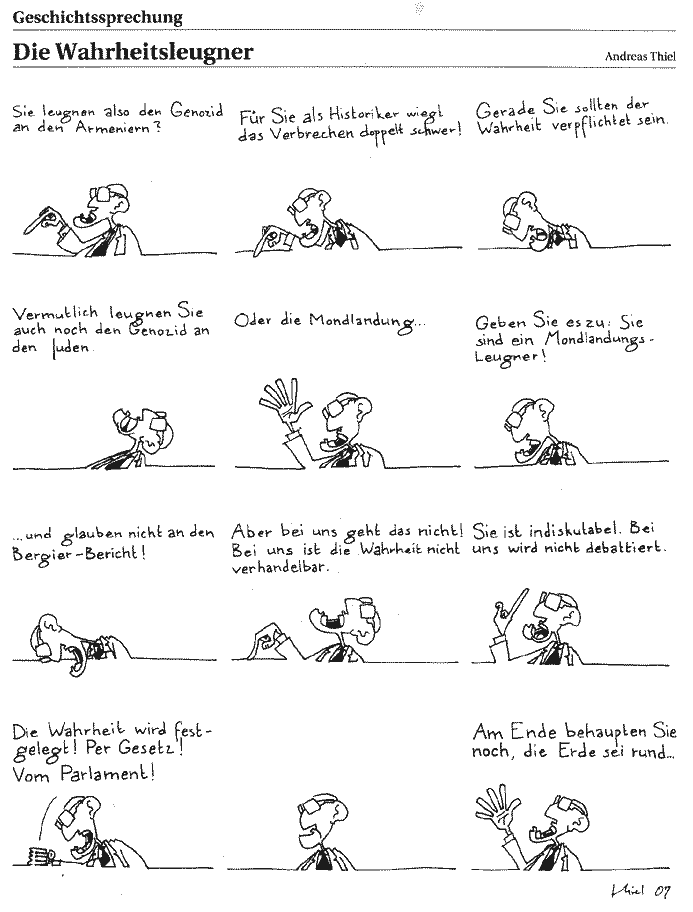Nichtigkeitsbeschwerde
an das Kassationsgericht des Kantons Zürich
vom 7. März 2005
(leicht gekürzt)
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Herren Kassationsrichter
im Verfahren gegen mich wegen Rassismus und Notwehrexzess (Urteil des Obergerichtes vom 29. November 2004) beantrage ich - mit Blick auf das grosse öffentliche Interesse der 30 000 VgT-Mitglieder, und darüber hinaus einer weiteren Öffentlichkeit, am Missbrauch der Justiz zu politischen Zwecken und insbesondere am Missbrauch des unbestimmten Rassendiskriminierungsverbotes zur Unterdrückung missliebiger Kritiker - die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
Unabhängig von der Eingabe meines Offizialverteidigers halte ich an der vorliegenden eigenen Beschwerdebegründung fest.
Das Mandat des erbetenen Verteidigers, Rechtsanwalt Dr Capt, musste inzwischen beendet werden, aus folgenden Gründen. Er hat gegenüber den Vorinstanzen wiederholt erklärt, dass er mich - mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Auslegung des unbestimmten Rassendiskriminierungsverbotes - nicht materiell verteidigen könne ohne Gefahr zu laufen, selber in ein Rassismusverfahren hineingezogen zu werden. Aus diesem Grund wurde mir ein amtlicher Verteidiger beigegeben. Nun ist noch dazu gekommen, dass im vorinstanzlichen Urteil der erbetene Verteidiger als "nicht nötig" beurteilt wurde, so dass dieser auch im Falle eines (Teil-)Freispruches nicht entschädigt werde.
Bezüglich des Umfangs der vorliegenden Beschwerdebegründung ist zu bedenken, dass es für mich um sehr viel geht. Da ich im gesamten vorinstanzlichen Verfahren in den Hauptanklagepunkten, in denen ich verurteilt wurde, trotz notwendiger Verteidigung nicht materiell verteidig war, ist eine gewisse Ausführlichkeit der vorliegenden Beschwerde unverzichtbar. Immerhin ist diese nicht umfangreicher als das vorinstanzliche Urteil ausgefallen, obwohl letzteres teilweise auch noch auf das erstinstanzliche Urteil verweist, welches allein schon umfangreicher als vorliegende Beschwerde ist.
Inhaltsverzeichnis
0. Vorbemerkungen
1. Der Angeklagte wurde der ersten Instanz beraubt -
massive Verletzung der Verteidigungsrechte
2. Menschenrechtswidrige Abwesenheit des Anklägers
3. Körperverletzung
4. Äusserungen zum Schächten
4.1 Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit / Nichtbeachtung der Berufspflicht
4.2 Bundesrechtswidrige, willkürliche Auslegung des Tatbestandsmerkmals "wegen ihrer Rasse"
4.3 Bundesrechtswidrige, willkürliche Auslegung des Tatbestandsmerkmals "eine Gruppe von Personen"
4.4 Willkürliche Beweiswürdigung
4.5 Menschenrechtswidrige Anklageschrift / Verletzung des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebotes
4.6 Der Angeklagte war vor beiden Vorinstanzen materiell nicht verteidigt
4.7 Diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit
durch diskriminierende Anwendung des Diskriminierungsverbotes
4.8 Unsachlich? Verfremdung als Stilmittel
4.9 Die inkriminierten Äusserungen im einzelnen
5. Gerichtsberichterstattung zum Fall
Graf (Gutachten Riklin)
6. Verletzung des rechtlichen Gehörs durch
Nichtbegründung der Strafart
7. Willkürliche Verweigerung des bedingten
Strafaufschubes
8. Vorverurteilung
9. Willkürlich falsche Darstellung der persönlichen
Verhältnisse
Aus der Weltwoche 23.02:
Antisemitismus-Debatte: Aufrüstung der Begriffe
... In diesem Zusammenhang erwähnte der Autor das berüchtigte Wort von Auschwitz als "Drohroutine", als "Einschüchterungsmittel" und als "Moralkeule". Keineswegs war damit eine Verdrängung oder gar Verharmlosung des Holocausts gemeint, sonder der Missbrauch, der mit dem Namen Auschwitz eben auch betrieben wird. Wer solche realpolitischen Befürchtungen äussert, läuft Gefahr, stigmatisiert zu werden. Offensichtlich ist das nun bei Walser geschehen. Wenn es so weitergeht, kann er bald schreiben, was er will, und man wird ihm Sätze wie "der Bodensee ist schön" als "intellektuellen und moralischen Skandal" auslegen.
Ein Neger ist nicht mehr ein Neger, sondern ein Schwarzer. Entwicklungsländer heissen Drittwelt-Länder. "Freistellen" hat nichts mit Ferien zu tun, sondern bedeutet Entlassung. Idioten nennt man politisch korrekt "Mitmenschen mit verlangsamten Hirnströmen". Beschönigend "nicht tiergerecht" nennen Fachleute und konservative Tierschutzvereine die Tierquälerei in Tierfabriken. In Österreich hat ein Gericht dem dortigen Verein gegen Tierfabriken verboten, die grässliche Käfigbatterie-Haltung von Hühnern in einem Kloster als "Tierquälerei" zu bezeichnen, weil diese Tierquälerei in Österreich erlaubt ist.
Der ehemalige FDP-Präsident Franz Steinegger sagte im Zusammenhang mit der jüdischen Kampagne gegen Botschafter Jagmetti, von der sich der Bundesrat wie üblich erpressen liess, treffend:
Wenn es so weitergeht, werden wir eine Diktatur der Sprache aufrichten, die uns vorschreibt, was wir sagen dürfen und was nicht
Derweil heucheln die Machthabenden bei jeder Gelegenheit eine rechtstaatlich-freiheitliche Demokratie:
Haben wir den Mut, die Realität zu sehen, wie sie ist. Beschimpfen wir nicht jene, die die Realität aufzeigen.
Bundesrat Samuel Schmid in seiner 1. August-Rede 2003 (Sonntags Zeitung vom 3.8.03)
Es gibt Menschen, die für ihre Hoffnung auf Gerechtigkeit alles aufs Spiel setzen und ihr eigenes Risiko nicht lange abwägen. Solche Menschen müssen einen Preis erhalten, denn es sind mutige Menschen, die sich nicht m kalten Kalkül verkriechen, sondern die uns helfen, an eine Welt zu glauben, wie wir sie uns vorstellen.
Bundesrat Moritz Leuenberger an der Prix-Courage-Galafeier 2004
Trotz diesen Schönredereien werden genau solche Menschen in der Schweiz ins Gefängnis geworfen.
Das Wort der Kleinen ist immer dumm,
Das Wort der Mächtigen oder Regierenden
in Kirche und Staat ist immer heilig.
Kein Gericht ist gerecht.
Es bestätigt nur die Hierarchie der Worte.
Schriftliches ist gefährlich.
Es wird daher zensuriert und gefoltert.
Ehrlich Schreibende werden eingesperrt,
weil ihre Worte nicht objektiv oder
ausgewogen seien..
Al Imfeld, Theologe und Vermittler zwischen Kulturen in seinem Büchlein "Zorn und Traurigkeit - Anstösse zu einer Medien-Philosophie"
Das war schon früher so.
Im 17./18. Jahrhundert sind die Täufer aus dem Emmental in die Berge des Jura ausgewandert... Lange waren sie heimgesucht worden von der Obrigkeit, geköpft, gepfählt, geschwemmt, verbrannt, gestreckt, gerädert, gevierteilt, weil sie mit der Reformation nicht auf halbem Wege stehen bleiben wollten... Zuerst ist jeweils von den staatlich gestützten Reformatoren ein 'Täufergespräch' angeordnet worden, und nachher hat man sie umgebracht, auch wenn sie gut argumentiert hatten, ganz nach dem Grundsatz: Give him a fair trial and hang him.
Niklaus Meienberg, "Vielleicht sind wir morgen schon bleich und tot - Chronik der fortlaufenden Ereignisse, aber auch der fortgelaufenen"
Im heutigen Unrechtsstaat Schweiz gibt man den zu Hängenden nicht einmal mehr ein fair trial - wie in dieser Beschwerde ausführlich dargelegt werden wird - weniger zuhanden der Richter, die das sowieso nicht wissen wollen, als vielmehr zuhanden der Geschichtsschreibung und späteren Historikerkommissionen, welche den Holocaust an den Nutztieren aufzuarbeiten haben werden. Nur wenige Kantone haben die Akten über die Hexenverbrennungen rechtzeitig vernichtet, viele haben dies vergessen, bis es zu spät war. So sind viele Dokumente dieser staatlichen Verbrechen, ausgeübt durch ehrenwerte studierte Richter, erhalten geblieben. Der letzte politische Justizmord an einer 'Hexe' hat der schweizerische Unrechtsstaat erst vor etwas mehr als 200 Jahren verübt; das unschuldige Kindermädchen Anna Göldin wurde 1782 verbrannt, weil sie zuviel wusste über die Untaten ihres Herrn, eines politisch Mächtigen (Franz Rueb: Hexenbrände - die Schweizergeschichte des Hexenwahns). Die Gerichte gaben sich damals als Mittel der Politik hin genau wie heute. Daran hat sich wenig geändert, nur werde ich nicht mehr verbrannt, sondern nur ins Gefängnis geworfen. Ein Kulturfortschritt - das anerkenne ich. Das Unrecht ist feiner geworden, raffinierter.
Es geht mir auch gnädiger als Giordano Bruno, dem jungen italienischen Mönch, der es wagte, die überlieferten Lehren der katholischen Kirchen anzuzweifeln und nach acht Jahren Folterhaft aufrecht und ohne widerrufen zu haben am 17. Februar des Jahres 1600 auf dem Scheiterhaufen in Rom ermordet wurde und zum Symbol des Kampfes für die Freiheit des Geistes geworden ist.
Ich werde auch nicht widerrufen. Unerträglicher als Gefängnis wäre es, wenn sich keine Stimme mehr laut und deutlich und mit passenden Worten gegen das Massenverbrechen an den so genannten "Nutztieren" erheben und die Heimatschutz-Fassade entlarven würde, hinter der sich nicht nur der dumpfe Egoismus der sich an Tierelend krank fressenden Masse, sondern auch die Verlogenheit und das Heuchlertum der Machthabenden und der religiösen Tierquäler in Klöster, Synagogen und Schlachthöfen verbirgt.
Der von islamistischen Führern zum Tod verurteilte englische Schriftsteller Salman Rushdie schrieb in der Weltwoche vom 24. Februar 2005:
In Grossbritannien machte die Regierung Tony Blairs im Rahmen ihres Gesetzes zur Bekämpfung der Schwerkriminalität und des organisierten Verbrechens den Vorschlag, es solle in Zukunft verboten sein, religiös motivierten Hass zu predigen. Offensichtlich müssen wir den Kampf für die Aufklärung in ganz Europa und den Vereinigten Staaten noch einmal führen. In diesem Kampf ging es einst um das Bestreben der Kirche, der Freiheit des Denkens Grenzen zu setzen. Die Aufklärung kämpfte nicht gegen den Staat, sondern gegen die Kirche. Diderots Roman «La Religieuse», in dem er das Leben und Verhalten von Nonnen beschrieb, war bewusst blasphemisch, eine Herausforderung an die kirchliche Autorität mit ihrem Index verbotener Schriften und ihrer Inquisition, die festlegten, was gesagt werden durfte. Die meisten unserer heutigen Vorstellungen über die Freiheit des Redens und Denkens stammen aus der Aufklärung. Möglicherweise haben wir geglaubt, der Kampf sei gewonnen. Aber wenn wir nicht aufpassen, könnte es schon bald geschehen, dass die Ergebnisse dieses Kampfes rückgängig gemacht werden.
Die Vorstellung, man könne eine freie Gesellschaft schaffen, in der niemand jemals beleidigt oder gekränkt würde, ist absurd. Dasselbe gilt für die Vorstellung, die Menschen sollten das Recht haben, sich mit rechtlichen Mitteln gegen Kränkungen und Beleidigungen zu wehren. Hier stehen wir vor einer grundlegenden Entscheidung: Wollen wir in einer freien Gesellschaft leben oder nicht? Die Demokratie ist keine Teegesellschaft, bei der die Leute höfliche Konversation treiben. In Demokratien werden Menschen sehr zornig aufeinander. Und sie argumentieren sehr heftig gegen die Ansichten des anderen. (Aber sie schiessen nicht.),,,
Menschen müssen vor jeder Rassendiskriminierung geschützt werden, aber man kann keinen Schutzzaun um ihre Meinungen errichten. Sobald man ein Ideensystem, ob nun einen religiösen Glauben oder eine weltliche Ideologie, für sakrosankt erklärt und es vor jeder Kritik, Satire, Herabsetzung oder Verächtlichmachung schützt, wird Gedanken- freiheit unmöglich. Mit dem Vorschlag, auf gesetzlichem Wege «zu verhindern, dass aus religiösen Gründen Hass gegen Menschen geschürt wird», hat die britische Regierung beschlossen, genau diese Unmöglichkeit herzustellen. ...Wenn wir nicht offen über lebenswichtige Ideen diskutieren dürfen, legen wir uns eine Zwangsjacke an. Genau das war der Ausgangspunkt der Aufklärung....
Die Menschen haben ein grundlegendes Recht, Argumentationen so weit zu treiben, dass ihre Aussagen andere Menschen beleidigen. Es ist keine Kunst, seinen Mitmenschen Redefreiheit zuzugestehen, wenn man mit ihren Ansichten übereinstimmt oder ihnen mit Gleichgültigkeit begegnet. Die Verteidigung der Meinungsfreiheit beginnt erst dort, wo jemand etwas sagt, das mir unerträglich ist. Wer dann nicht die Meinungsfreiheit des anderen verteidigen kann, der glaubt nicht an die Meinungsfreiheit...
Wir dürfen nicht zulassen, dass Frömmler die Freiheit des Denkens, der Rede und der Fantasie abschaffen.
Unmenschen dürfen im heutigen schweizerischen Unrechtsstaat nicht mehr als solche bezeichnet werden. Das gilt allerdings nur, wenn die Unmenschen Juden sind. Nazis dürfen - ja müssen, damit es politisch korrekt ist - als die allerschlimmsten Unmenschen bezeichnet werden. Wer sich nicht an diese staatliche Sprachregelung hält, wird mit Gefängnis bestraft.
Das vorinstanzliche Urteil des Obergerichtes verletzt massenhaft das rechtliche Gehör, wie im folgenden einzeln dargelegt wird. Im sog ersten Schächtprozess hat das Kassationsgericht die Beschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Obergericht mit der Begründung abgewiesen, es genüge, wenn Vorbringungen im Urteil stillschweigend als unbegründet übergangen würden. Das kann indessen nicht Sinn und Zweck der Begründungspflicht sein, denn erstens kann Stillschweigen in der Urteilsbegründung auch bedeuten, dass etwas übersehen wurde, zweitens soll die Urteilsbegründung dem Verurteilten aufzeigen, weshalb er trotz seinen Einwänden verurteilt wurde und drittens soll ihm die Urteilsbegründung ermöglichen, gezielt von Rechtsmittelmöglichkeiten Gebrauch zu machen (wirksame Verteidigung im Sinne von EMRK 6). Es ist willkürlich und mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens im Sinne von EMRK 6 nicht vereinbar, wenn dem Sachrichter einerseits zugestanden wird, wichtige und urteilsentscheidende Einwände stillschweigende zu übergehen, andererseits dann aber sehr hohe, geradezu überspitzt formalistische Anforderungen an die Begründung einer Kassationsbeschwerde gestellt werden. Wie soll ein Verurteilter eine Kassationsbeschwerde genau begründen, wenn er die Erwägungen der Vorinstanz gar nicht kennt?!
1. Der Angeklagte (VgT-Präsident Dr Erwin Kessler) wurde der ersten Instanz beraubt - schwerwiegende Verletzung der Verteidigungsrechte
1.1
Am 5. Dezember 2001 verurteilte das Bezirksgericht Bülach Erwin Kessler (Angeklagter/Beschwerdeführer BF) im Abwesenheitsverfahren. Ein vom BF eingereichtes schriftliches Plädoyer sowie beigefügte Beweisanträge wurden mit Beschluss vom 5. Dezember 2001 aus dem Recht gewiesen. Dieser Beschluss ist im späteren Verfahren nie aufgehoben worden.
1.2
Das Urteil des Bezirksgerichtes Bülach vom 5. Dezember 2001 wurde mit Beschluss der II. Strafkammer des Obergerichtes vom 20. August 2002 (DG 020100) aufgehoben, und die Sache wurde i.S. von § 427 StPO zur Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens an das BG Bülach zurückgewiesen. Zur Begründung hielt das Obergericht fest, der Angeklagten/BF (Erwin Kessler) sei nicht gehörig verteidigt gewesen.
1.3
Auch im zweiten Durchgang vor erster Instanz erfolgten schwerwiegende Verfahrensfehler - Fehler, die bewirkten, dass nicht mehr von einem ordnungsgemässen, die zentralen Verteidigungsrechte des Angeklagten wahrenden, Verfahren gesprochen werden kann und der Angeklagte damit praktisch um eine Instanz gebracht wurde (Verletzung von BV 32.1, vgl. auch Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, N8 ff. zu § 427 StPO). Insbesondere war der Angeklagte/BF - wie noch im Einzelnen dargelegt wird -, in allen Anklagepunkten, in denen er verurteilt wurde, materiell nicht verteidigt und damit auch nicht wirksam verteidigt im Sinne von BV32.2 und EMRK 6, obwohl ein Fall notwendiger Verteidigung vorlag (Verletzung der Verteidigungsrechte gemäss BV 32.2 und EMRK 6).
Die Vorinstanz (Obergericht) stellt im angefochtenen Entscheid zu Recht fest (Seite 34, Ziff i. kk), dass der Angeklagte auch bei der Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens nicht gehörig verteidigt gewesen sei, wörtlich:
... kann ein solches Vorgehen nicht als gehörige Verteidigung anerkannt werden. Dies gilt umso mehr, als dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von erheblicher Dauer und ohne Vollzugsaufschub drohte und sich zumindest teilweise auch in rechtlicher Hinsicht schwierige Fragen stellten, mit denen der Angeklagte allein überfordert sein musste. Da ein Fall notwendiger Verteidigung vorlag, hätte die Vorinstanz die Weigerung der amtlichen Verteidigerin, zu allen Anklagepunkten materiell zu plädieren, nicht hinnehmen dürfen. Sie hätte vielmehr das Hauptverfahren erneut unterbrechen und dem Angeklagten vor dessen Fortsetzung einen anderen amtlichen Verteidiger bestellen müssen. Indem sie dies unterliess und stattdessen - nach der expliziten Feststellung des Vorsitzenden, dass nach wie vor nicht zu allen Anklagepunkten materiell plädiert worden sei - zur Urteilsfällung schritt, verletzte er die Verteidigungsrechte des Angeklagten. Beizufügen ist, dass bei notwendiger Verteidigung unerheblich ist, ob die Verteidiger es mit dem Einverständnis oder sogar auf Wunsch des Angeklagten unterliessen, ihn gehörig zu verteidigen, und deshalb nicht zu prüfen ist, wie sich damit verhält. Irrelevant ist ferner, ob sich die ungenügende Verteidigung tatsächlich zum Nachteil des Angeklagten auswirkte.
Diesen zutreffenden Feststellungen ist inhaltlich nichts beizufügen. Hingegen ist die anschliessende Behauptung der Vorinstanz (Seite 35, Ziff 6 i. ll) nicht nachvollziehbar und willkürlich, es handle sich dabei um einen "nicht besonders stark ausgeprägten Verfahrensmangel". Kommt dazu, dass die anschliessende Feststellung der Vorinstanz, dieser Mangel könne mit der Gewährleistung einer besseren Verteidigung im Berufungsverfahren geheilt werden, ebenfalls ins Leere stösst, war dies doch im Berufungsverfahren gerade auch nicht der Fall und der BF dort ebenfalls nicht materiell verteidigt.
Die Vorinstanz handelt auch insofern widersprüchlich, als sie das erste erstinstanzliche Verfahren wegen "nicht gehöriger Verteidigung" an die erste Instanz zurückwies, das zweite mal trotz gleicher Feststellung jedoch nicht mehr.
Um die fehlende materielle Verteidigung zu kaschieren, stilisiert die Vorinstanz einzelne Sätze der Verteidigung zu einer materiellen Verteidigung hoch (Seite 35, Ziff 6. i. j). Es kommt indessen nicht darauf an, ob die Verteidigung irgendwo irgend eine Bemerkung zur Anklage gemacht hat, sondern ob eine menschenrechtskonforme, gehörige, dh wirksame Verteidigung vorlag, was eben offensichtlich und unbestritten nicht der Fall war. Das verletzt die Garantie eines fairen Verfahrens (wirksame Verteidigung) gemäss EMRK 6.
1.4
Es kann deshalb nicht von einer ordnungsgemässen Hauptverhandlung gesprochen werden. Dies ist um so befremdender, als das erstinstanzliche Verfahren ja bereits wegen ungenügender Verteidigung des Angeklagten wiederholt werden musste. Auch bei der Wiederholung des Verfahrens fehlte eine materielle Verteidigung und stützte die erste Vorinstanz ihr Urteil - mit Ausnahme einer kurzen Befragung des Angeklagten - vollständig auf die Akten des ersten Verfahrens, insbesondere auf das im ersten Verfahren eingereichte schriftliche Plädoyer des BF, obwohl dieses aus dem Recht gewiesen und formell nicht wieder zu den Akten genommen wurde.
1.5
Damit (Ziffer 1.4) stützt sich das Urteil auf Akten, die rechtlich nicht bei den Verfahrensakten waren - ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
1.6
Am 19. Mai 2003 stellte der erbetene Verteidiger ein Gesuch um Verschiebung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, weil ihm die Nachtragsanklage vom 28. April 2003 nicht zugestellt worden war und er davon erst wenige Tage vor der Verhandlung erfuhr. Das stellte eine schwerwiegende Behinderung der Verteidigung dar.
Die Vorinstanz rechtfertigt diese Nichtzustellung der Nachtragsanklage an den erbetenen Verteidiger damit (Seite 20), dieser habe zuvor erklärt er könne den Angeklagten bezüglich der Rassismusanklage nicht materiell verteidigen, ohne selber ein Rassismusstrafverfahren zu riskieren, die erste Instanz habe deshalb annehmen dürfen, der erbetene Verteidiger brauche diese Rassismus betreffende Anklage nicht.
Der erbetene Verteidiger hat den Angeklagten im gesamten Verfahren verteidigt und insbesondere zu prozessualen Fragen ausführlich Stellung genommen und lediglich erklärt, er könne bezüglich Rassismus nicht materiell verteidigen. Dass ihm deshalb eine Nachtragsanklage überhaupt nicht zugestellt wurde und ihm damit auch eine Verteidigung des Angeklagten in prozessualen Fragen verunmöglicht wurde, stellt eine willkürliche Behinderung der Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 dar. Solche Schlampereien können in einem Verfahren, wo es um Menschenrechtseingriffe mit unbedingter Gefängnisstrafe geht, nicht hingenommen werden.
Daran ändert sich dadurch nichts, dass die Verhandlung unterbrochen und erst Monate später fortgesetzt wurde, denn gewisse prozessuale Einwände können bekanntlich nur zu Beginn der Verhandlung geltend gemacht werden.
1.7
Die mehrfach beantragte Einvernahme des einzigen Augenzeugen P.B. (Eingabe an die Bezirksanwaltschaft vom 12. Juli 1999; schriftliche Eingabe an der Hauptverhandlung vom 7. November 2001; und dann nochmals von beiden Verteidigern bei der Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens, siehe das erstinstanzliche Urteil Seite 91) wurde wiederum ohne jede Begründung nicht durchgeführt (siehe Rückweisungsgesuch vom 13. Mai 2004, Ziffer 1.2). Über die Beweisanträge des erbetenen Verteidigers anlässlich der Verhandlung vom 28. Mai 2003 (Urk. 26 S. 2, ausdrücklich nochmals gerügt in der Eingabe des erbetenen Verteidigers vom 18. August 2003, , Seite 1) sowie der amtlichen Verteidigerin anlässlich der Verhandlung vom 3. September 2004 fasste die erste Instanz stillschweigend und ohne jede Begründung keinen Beschluss - nicht einmal zusammen mit dem Urteil (siehe Rückweisungsgesuch vom 13. Mai 2004, Ziffer 1.2). Damit verletzte die erste Instanz in krasser Weise die Verteidigungsrechte des Angeklagten: das Recht auf eine wirksame Verteidigung, das Recht auf den Beweis und das rechtliches Gehör (Ignorierung von Beweisanträgen).
Die gegenteilige Behauptung der Vorinstanz (Seite 26, lit g), dieser Einwand des erbetenen Verteidigers, die Beweisanträge seien ohne Begründung verworfen worden, sei unzutreffend, ist aktenwidrig. Die Vorinstanz verweist auf "S. 90 ff, insbes. S. 97" des erstinstanzlichen Urteils; indessen sucht man hier vergebens nach irgend einer Erwägung zum beantragten Zeugen P.B. und zur beantragten Tatortbesichtigung. Nirgends findet sich eine Ablehnung dieser Beweisanträge und schon gar nicht auch nur ein einziges Wort der Begründung. Dies ist umso unverständlicher, als (Seite 93) festgehalten wird, der Sachverhalt sei "nicht gesichert". Die erste Instanz behauptet zwar, diese Unsicherheit zugunsten des Angeklagten gewürdigt zu haben, was sie dann aber nicht oder zumindest nicht konsequent tat. Siehe dazu Ziff 1.18, ferner auch Ziff 3.5 bis 3.14
1.8
Rechtliches zu Ziffer 1.7: "Das Bundesgericht betrachtet das rechtliche Gehör als verletzt, wenn einem anerbotenen Beweismittel ohne sachliche Gründe im vornherein jede Erheblichkeit abgesprochen wird" (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, Seite 524). Dieser Fall liegt hier vor. Die erste Instanz hat zu den Beweisanträgen überhaupt nicht Stellung genommen und über diese nicht entschieden. Damit ist das rechtliche Gehör massiv verletzt und das erstinstanzliche Verfahren zur blossen Farce geworden.
Der BF beantragte die Einvernahme des Zeugen P.B. bereits im Untersuchungsverfahren (Eingabe an die Bezirksanwaltschaft vom 12. Juli 1999) und dann nochmals mit schriftlicher Eingabe an der Hauptverhandlung vom 7. November 2001. Schon die Bezirksanwaltschaft hatte diesen Antrag pflichtwidrig ignoriert und war in Verletzung von § 31 StPO einseitig nur den belastenden Tatsachen nachgegangen. Trotzdem wurde der Antrag auf Rückweisung des Verfahrens zur Vervollständigung der Untersuchung an die Bezirksanwaltschaft abgewiesen. Als Begründung gab die erste Instanz an, das Gericht könne Beweisergänzungen selber vornehmen (Erw. S. 13), machte das dann aber doch nicht.
Auf S. 13 der Erwägungen führte die erste Instanz dazu aus, um die Frage nach der Erforderlichkeit einer Beweisergänzung beantworten zu können, müsse sich das Gericht zwangsläufig zuerst materiell mit der Sache befassen. Analoges gilt indessen auch umgekehrt für die Verteidigung, die den Angeklagten erst dann wirksam verteidigen kann, wenn bekannt ist, was der einzige Augenzeuge gesehen hat. Hier zeigt sich der Nachteil deutlich, der dem Angeklagten daraus erwachsen ist, dass in der Untersuchung nur einseitig nach Belastendem gesucht wurde.
Es geht hier nicht eigentlich um "Beweisergänzungen", wie sie etwa notwendig werden, wenn die Verteidigung erst im gerichtlichen Verfahren entsprechende Anträge stellt, sondern um gravierende Mängel des Untersuchungsverfahrens. Der Zeuge P.B. wurde schon im Untersuchungsverfahren beantragt, jedoch ohne jede Begründung und zu Unrecht nicht einvernommen. Unter solchen Umständen von der Verteidigung zu verlangen, materiell zu plädieren, bevor der Zeuge einvernommen wird, stellt eine unzulässige und schwerwiegende Behinderung der Verteidigung dar (EMRK 6) und führte dazu, dass der Angeklagte vor erster Instanz materiell überhaupt nicht verteidigt war.
Die erste Instanz beanspruchte für sich, über die beantragten Beweisergänzungen erst nach den Plädoyers der Verteidigung befinden zu können, verweigerte damit aber der Verteidigung das Recht, erst in Kenntnis der Aussagen des rechtzeitig beantragten Augenzeugen materiell plädieren zu können. Und dies wäre der normale, durch die Verteidigungsrechte gebotene Ablauf einer Hauptverhandlung, eine Auffassung, die auch von Hauser/Schweri in "Schweizerisches Strafprozessrecht" (5. Aufl., § 82.10) klar vertreten wird: "Ist das Beweisverfahren abgeschlossen, so äussern sich Staatsanwalt, Geschädigter und Verteidiger zu Anklage...". Und (§ 82.6): "Ob und inwieweit das Gericht auch Zeugen, Auskunftspersonen oder Sachverständige anhört und einen Augenschein durchführt, entscheiden das Kollegium oder der Vorsitzende tunlichst vor der Hauptverhandlung...".
Zu diesem schwerwiegenden Mangel des Untersuchungsverfahrens - Nichteinvernahme des entlastenden Kronzeugen (einziger Augenzeuge) -, den die Verteidigung in den Plädoyers vor erster Instanz wie auch im Rückweisungsgesuch vor zweiter Instanz rügte, äusserten sich beide Vorinstanzen nicht substanziert. Damit wurde das rechtliche Gehör in einem wichtigen Punkt verletzt - ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
Siehe dazu auch Ziff 3.5 bis 3.14
1.9
Im ersten Verfahren vor BG Bülach wurde der Belastungszeuge Wettstein in Abwesenheit des Angeklagten und seines Verteidigers gerichtlich einvernommen. Diese Einvernahme wurde bei der vom Obergericht angeordneten Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens nicht wiederholt.
Die Vorinstanz rechtfertigt dies damit (Seite 10), der Zeuge Wettstein habe vor Bezirksgericht "nichts grundlegend anderes" ausgesagt als in der Untersuchung. Diese Feststellung der Vorinstanz basiert auf dem Ergebnis einer ungültigen und damit unbeachtlichen Zeugeneinvernahme in dem vom Obergericht für ungültig erklärten ersten erstinstanzlichen Verfahren - ein absoluter Nichtigkeitsgrund. Es kann selbstverständlich nicht angehen, dass eine vom Obergericht angeordnete Wiederholung eines erstinstanzlichen Verfahrens bezüglich Zeugeneinvernahmen nicht wiederholt wird, weil dies aufgrund des Ergebnisses des ersten, aufgehobenen Verfahrens als nicht nötig befunden wird.
Die Vorinstanz hält zu recht fest (Seite 10), dass darin ein Widerspruch liege, weil das Bezirksgericht die Einvernahme des Zeugen Wettstein für nötig erachtet habe und erst aufgrund des Ergebnisses dann auch die Wiederholung verzichtet habe. Die Vorinstanz hat aus dieser Feststellung aber nicht die nötige Konsequenz gezogen und das (zweite) Rückweisungsgesuch offensichtlich zu Unrecht abgewiesen, denn es lag nicht im Ermessen des Bezirksgerichtes, die vom Obergericht angeordnete Wiederholung dese Verfahrens nach Gutdünken nur teilweise durchzuführen.
Der Einwand der Vorinstanz (Seite 10), eine gerichtliche Einvernahme des Zeugen Wettstein sei nicht erforderlich gewesen, weil Wettstein schon in der Untersuchung einvernommen worden sei, ist haltlos:
Da der Angeklagte materiell nicht verteidig war, stützte die erste Instanz die Verurteilung einseitig auf die Aussagen des Geschädigten Wettstein ab (sowie in ungültiger Weise auf das vom Angeklagten im ersten Verfahren eingereichte und dann - nicht widerrufen - aus dem Recht gewiesene schriftliche Plädoyer des Angeklagten). In einem solchen Fall muss der einzige Zeuge gerichtlich einvernommen werden. Gemäss Frowein/Beukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Rz 108 zu Art. 6 EMRK, gilt folgendes: "Kommt es für eine Verurteilung ausschliesslich auf die Aussage eines Zeugen an, ist dieser in Gegenwart des Angeklagten vom erkennenden Gericht zu hören. Eine frühere Aussage eines solchen Zeugen kann, wenn er bei der Hauptverhandlung nicht verfügbar ist, grundsätzlich nur dann berücksichtigt werden, wenn seinerzeit Gegenüberstellung mit dem Angeklagten erfolgte."
1.10
Die Vorinstanz räumt ein (Seite 33), dass der Angeklagte bezüglich Körperverletzung vor erster Instanz nicht materielle verteidigt war.
Auch betreffend der Anklage wegen Rassendiskriminierung, bezüglich welcher der BF erstinstanzlich verurteilt wurde, fand keine materielle Verteidigung statt. Die erste Instanz stützte ihr zweites Urteil in Nichtbeachtung des Rückweisungsentscheides ausschliesslich auf die Akten des ersten Verfahrens.
1.11
Damit blieb der Angeklagte gerade in den beiden Hauptanklagepunkten ohne materielle und damit ohne wirksame Verteidigung (Verletzung von EMRK 6.3).
Wie die Vorinstanz richtig feststellt (Seite 24), hat der erstinstanzliche Präsident der amtlichen Verteidigerin vorgehalten, ihren Pflichten nicht nachzukommen. Offensichtlich war er der Auffassung, dass ohne materielles Plädieren der Angeklagte nicht genügend verteidigt sei, unternahm aber nichts, als die amtliche Verteidigerin antwortete, sie nehme den Vorhalt zur Kenntnis, bleibe aber bei der Weigerung, vor der Einvernahme des Zeugen P.B. materiell zu plädieren. Die Vorinstanz wies das Rückweisungsgesuch ab, ohne sich zu diesem wichtigen Punkt zu äussern.
Die zahlreichen Rügen wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs deuten darauf hin, dass die Vorinstanz die Strategie verfolgt hat, sich zu allen Punkten, wo dem Angeklagten Recht gegeben werden müsste, einfach nicht zu äussern.
1.12
Die durch EMRK 6 garantierten fundamentalen Verteidigungsrechte eines jeden Angeklagten gelten gemäss Praxis des EGMR im gesamten Verfahren. Es genügt für eine wirksame Verteidigung im Sinne von EMRK 6.3 nicht, wenn die materiellen Verteidigungsrechte erst im Rechtsmittelverfahren vor der letzten materiellen Instanz gewährt werden. Dieser schwere, menschenrechtswidrige Mangel kann nur durch eine Rückweisung an die erste Instanz geheilt werden. Indem das Obergericht das Rückweisungsgesuch vom 13. Mai 2004 ohne plausible Begründung abwies, hat es diesen schwerwiegenden Verfahrensmangel nicht beseitigt, sondern zementiert, zumal, wie noch dargelegt wird, auch im Berufungsfverfahren keine materielle Verteidigung stattfand - und dies in einem Verfahren, wo es um schwere Grundrechtseingriffe, nämlich um eine mehrmonatige unbedingten Gefängnisstrafe vorwiegend wegen (angeblichen) Pressedelikten geht.
1.13
Gemäss Praxis des EGMR zu Art. 6 EMRK haben "die Behörden dafür zu sorgen, dass die Offizialverteidigung während des gesamten Strafverfahrens wirksam durchgeführt wird. Stellen sie Mängel in der Verteidigung fest, obliegt es ihnen, den betreffenden Verteidiger auf seine Pflichten hinzuweisen, allenfalls auch einen neuen Verteidiger zu bestellen" (Villiger, Handbuch der EMRK, 2. Aufl., Rz 521).
1.14
Art. 6 ERMR garantiert jedem Angeklagten ausdrücklich das Recht auf eine wirksame Verteidigung (Villiger, a.a.O., Rz 524). In Fällen der unzureichender Verteidigung und der Verweigerung des rechtlichen Gehörs hat zur Wahrung des durch die Bundesverfassung und die EGMR-Praxis garantierten Anspruchs auf Beurteilung des Falles durch zwei Instanzen eine Rückweisung an die Vorinstanz zu erfolgen (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Rz 1044; Donatsch/Schmid, Kommentar zur StPO des Kantons Zürich, § 427, Rz 8, 11 und 12).
1.15
Gemäss Schmid, Rz 500, hat das Gericht "in Fällen notwendiger Verteidigung selbst für eine auch materiell ausreichende Verteidigung besorgt zu sein. Eine im Berufungsverfahren festgestellte ungenügende Verteidigung vor der Vorinstanz führt zur Rückweisung des Falles zur Wiederholung des bezirksgerichtlichen Verfahrens. Ohne genügende Verteidigung leidet das hernach ergehende Urteil am Nichtigkeitsgrund von StPO 430 I Ziff 4.".
1.16
Die Vorinstanz hat sich mit den Argumenten gemäss den Ziffern 1.11 bis 1.15, welche schon im Rückweisungsgesuch vom 13. Mai 2004, Ziffer 1, vorgebracht wurden, nicht auseinandergesetzt und damit das rechtliche Gehör verletzt.
1.17
Die Vorinstanz zitiert (Seite 29 ff) einige wenige kurze und allgemeine Bemerkungen der Verteidiger und beurteilt diese als "materielle Verteidigung" - ein mehr als überspitzt formalistischer Standpunkt. In einem komplexen Strafverfahren, in welchem es um eine unbedingte Gefängnisstrafe von 12 Monaten geht und in dem allein schon die Anklageschriften, welche schlussendlich zur Verurteilung führten, über 29 Seiten angeblich deliktisches Verhalten des Angeklagen auflistet, können zwei oder drei Sätze Randbemerkungen dazu wohl nicht als "materielle Verteidigung" qualifiziert werden, jedenfalls nicht im Sinne von EMRK 6.
Der BF macht im übrigen gar nicht geltend, die amtliche Verteidigerin habe ihre Pflicht verletzt, vielmehr geht es darum, dass aus den dargelegten Gründen eine wirksame, menschenrechtskonforme materielle Verteidigung durch den vom Gericht gewählten Verfahrensablauf verhindert bzw unzumutbar gemacht wurde.
1.18
Das erstinstanzliche Urteil ist ferner widersprüchlich, wie im Rückweisungsgesuch vom 13. Mai 2004, Ziffer 1.2.8 dargelegt wurde. Die Vorinstanz hat sich damit nicht befasst und damit das rechtliche Gehör verletzt. Einerseits wird im erstinstanzlichen Urteil unter XVIII Ziffer 1 behauptet, der Geschädigte habe eine schwere Augenentzündung erlitten, ohne dass sich dies dem ärztlichen Zeugnis entnehmen lässt. Zum Widerspruch mit dem angenommenen einmaligen, kurzen Spray-Einsatz (XVIII Ziffer 2 c) äussert sich das Urteil nicht. Die Urteilsbegründung ist darum widersprüchlich - ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
1.19
Welche Äusserungen zum Schächten dem Angeklagten als rassendiskriminierend vorgehalten wurden, war aus der Anlageschrift vom 8. August 2000 nicht genau ersichtlich, wie nachfolgend unter Ziffer 5.11 erläutert wird. Der Angeklagte und seine Verteidiger erfuhren erst aus dem erstinstanzlichen Urteil genau, welche Äusserungen rassendiskriminierend sein sollen. Dadurch wurde eine wirksame Verteidigung verunmöglicht und der Angeklagte der ersten Instanz beraubt.
1.20
Gemäss Praxis des EGMR ist die Verletzung der grundlegenden Verteidigungsrechte immer unzulässig, unabhängig davon, ob sie sich für den Angeschuldigten konkret nachteilig auswirken oder nicht (Villiger, EMRK-Kommentar, 2. Aufl, Rz 509). Es handelt sich somit um absolute Nichtigkeitsgründe. Die Nichtigkeit des erstinstanzlichen Urteils zieht die Nichtigkeit des angefochten zweitinstanzlichen Urteils nach sich, da ein Berufungsverfahren nur aufgrund eines gültigen erstinstanzlichen Urteils zulässig ist. Das Obergericht hätte dem Rückweisungsgesuch des BF vom 13. Mai 2004 folgen und das erstinstanzliche Urteil formell aufheben müssen, anstatt ein materielles Berufungsverfahren durchzuführen.
1.21
Zusammenfassung der Nichtigkeits-Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens:
- Keine materielle Verteidigung.
- Widersprüchliches Urteil.
- Ein schon in der Untersuchung und dann nochmals im erstinstanzlichen Verfahren beantragter Kronzeuge (P.B.) wurde ohne Begründung und zu Unrecht nicht einvernommen.
Mit den dargelegten zahlreichen und schwerwiegenden Verletzungen fundamentaler Verteidigungsrechte wurde der Angeklagte/BF faktisch der ersten Instanz beraubt. Gemäss BV 32.3 und Praxis des EGRM zu EMRK 6 hat ein Angeklagter ein grundlegendes Anrecht auf zwei Instanzen. Kassations- und Verfasssungsgerichte genügen den Anforderungen an eine zweite Instanz nicht, weil diese nicht das "Urteil überprüfen", sondern nur Rechtsfragen beurteilen dürfen.
2. Menschenrechtswidrige Abwesenheit des Anklägers
Der Strafantrag des Anklägers (Staatsanwaltschaft) beträgt 12 Monate Gefängnis unbedingt. Vor erster Instanz war der Ankläger nicht anwesend, im Berufungsverfahren erst bei der Fortsetzung der Verhandlung, wo es einzig noch um die Anklage betreffend Körperverletzung ging. Dadurch mussten die Vorinstanzen zum grossen Teil auch die Rolle des Anklägers übernehmen. Das in EMRK 6 garantierte Recht auf ein unabhängiges Gericht wurde dadurch verletzt.
Die Verteidigung hat die Abwesenheit des Anklägers in ihren Plädoyers vor beiden Vorinstanzen erfolglos gerügt. (Plädoyer-Notizen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 28. Mai 2003 des erbetenen Verteidigers, Ziffer 2.1)
Die Abwesenheit des Anklägers war umso schwerwiegender, als es um massive Eingriffe in die Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit ging, der Angeklagte in allen Anklagepunkten nicht geständig war und die Verteidigung gravierende Mängel der Untersuchung und der Anklageschrift geltend machte und Beweisanträge stellte.
Die Vorinstanz geht nicht ernsthaft auf diese Problematik ein und verweist "auf die zutreffenden Erwägungen" der ersten Instanz. Diese verwies indessen (Seite 26 lit h) lediglich auf die StPO, wonach der Ankläger bei einem nicht geständigen Angeklagten lediglich anwesend sein müsse, wenn mehr als 12 Monate Gefängnis beantragt seien, in casu seien aber lediglich 12 Monate beantragt. Mit der von der Verteidigung vorgebrachten menschenrechtlichen Problematik setzten sich beide Vorinstanzen nicht auseinander (Verletzung des rechtlichen Gehörs).
3.
Körperverletzung (Anklageschrift vom 19. April 2001)3.1
Zum fraglichen Zwischenfall kam es wegen eines Spruchbandes des VgT, das den Kläger Wettstein überhaupt nichts anging. Er provozierte leichtfertig und ohne Anlass eine Notwehrsituation, indem er den BF (Erwin Kessler) und dessen Begleiter P.B. beim Eindunkeln in den Wald hinein verfolgte und diese dort zuerst verbal provozierte und sie anschliessend bewusst und vorsätzlich am Wegfahren hinderte (siehe Zeugenaussage P.B.).
Auf Seite 60, lit cc), behauptet die Vorinstanz unter Hinweis auf das erstinstanzliche Prot I S. 32/33, der BF habe vor Bezirksgericht ausgesagt, der Geschädigte Wettstein habe sich nach einer Viertelstunde von sich aus entfernt. Diese Feststellung beruht auf einer durch verkürzte Protokollierung ins Gegenteil verkehrten Aussage des BF. Der neue Verteidiger des BF hat eine Protokollberichtigung verlangt. Der korrekte Sachverhalt ist folgender: Der BF hat Wettstein nicht abfahren sehen, vielmehr ist er vor diesem weggefahren. Wettstein hat dann später ausgesagt, er sei rund eine Viertelstunde nach dem Zwischenfall heimgefahren. Der BF hat auf diese Aussage Wettsteins bezug genommen, nicht auf eine eigene Feststellung. Sollte dies durch die verlangte Protokollberichtigung sowie anhand der Zeugeneinvernahmen P.B. und Wettstein, welche dem BF nicht vorliegen, nicht ausreichend geklärt werden können, müssten diese Zeugeneinvernahmen diesbezüglich ergänzt werden.
Aktenwidrig ist die Behauptung der Vorinstanz (Seite 62, lit e), der Arzt habe beim Geschädigten eine "schwere Konjunktivitis (Bindehautentzündung)" festgestellt. Im Arztzeugnis steht nichts von einer "schweren" Augenentzündung, vielmehr dass ein Augenleiden vorbestanden habe.
Willkür und Aktenwidrigkeit stellt einen absoluten Nichtigkeitsgrund dar.
3.2
Pfeffersprays sind ohne Waffenschein erhältlich und dürfen von jedermann frei mitgeführt werden, weil das Reizgas nicht gesundheitsschädlich ist. Nachdem der Kläger/Geschädigte auf mehrere Warnungen, den Weg freizugeben nur mit höhnischem Grinsen und demonstrativem Arme-Verschränken und gemütlichem Anlehnen an sein Fahrzeug zum Ausdruck brachte, er werde dem Angeklagten den Weg noch lange nicht freigeben, gerade so lange es ihm eben beliebe (teilweise vom Zeugen P.B. zutreffend so geschildert; teilweise konnte sich der menschenrechtswidrig erstmals vor Obergericht einvernommene Zeuge nicht mehr an diese wichtigen Einzelheiten erinnern, was nicht dem BF angelastet werden darf, weil es eine Folge der menschenrechtswidrigen Verfahrensverschleppung ist), stellte der Einsatz eines Pfeffersprays das mildeste Notwehrmittel dar. Als Alternative kam nur die Anwendung physischer Gewalt mit schwer abschätzbaren Verletzungsfolgen in Frage. Soweit wollte der BF nicht gehen, obwohl er dazu berechtigt gewesen wäre. Es wäre durchaus verständlich, wenn er nach den vorausgegangen längeren verbalen Provokationen bei der anschliessenden klar rechtswidrigen Nötigung die Geduld verloren und direkt körperliche Gewalt angewendet hätte. Soweit ist der BF nicht gegangen, obwohl er dazu berechtigt gewesen wäre. Er hat sich trotz Wut und Empörung über des höhnische Grinsen des den Weg versperrenden Klägers beherrscht.
3.3
Die Vorinstanz räumt ein, dass eine Notwehrsituation bestanden hat (Seite 64-65) und der Einsatz des Pfeffersprays das mildest mögliche Mittel gewesen sei, hält dem BF jedoch vor, damit eine unverhältnismässige Verletzung des Angreifers inkauf genommen zu haben (Seite 65); zudem sei der Pfeffersprayeinsatz kaum ein taugliches Mittel gewesen (Seite 66).
Diese Auffassung begründet die Vorinstanz damit (Seite 64ff),
a) die Nötigung (Blockade) hätte voraussichtlich nicht lange gedauert,
b) beim Einsatz des Pfeffersprays sei mit "nicht unbedeutenden Verletzungen" an den Augen zu rechnen gewesen,
c) mit dem Pfeffersprayeinsatz habe sich das Auto des Geschädigten nicht wegstellen lassen.
Alle diese Erwägungen sind haltlos, beruhen auf Mutmassungen anstatt auf Beweisen und stellen eine willkürliche Beweiswürdigung dar.
Zu a):
Die Vorinstanz hat den Umstand ausser acht gelassen, dass der Angreifer/Geschädigte die Blockade einzig und allein mit dem Ziel vorgenommen hat, um als Tierhalter am BF (Tierschützer) seinen Hass abzureagieren, ihn zu "bestrafen" und wohl auch, um nachher am Stammtisch damit prahlen zu können, er habe es dem Kessler gezeigt. Diese Haltung kam schon vorher bei seinen verbalen Provokationen zum Vorschein. Insoweit sich der menschenrechtswidrig erst 5 Jahre nach dem Zwischenfall einvernommene Zeuge P.B. daran nicht mehr im Detail erinnern konnte, ist das eine Folge der menschenrechtswidrigen Verfahrensverschleppung und darf nicht zu Ungunsten des BF interpretiert werden. Die durch diese menschenrechtswidrig verspätete Einvernahme des Kronzeugen entstanden Sachverhaltsunklarheiten hätte die Vorinstanz zugunsten des Angeklagten würdigen müssen. Indem sie dies nicht tat hat sie die den Grundsatz in dubio pro reo verletzt (Unschuldsvermutung gemäss EMRK 6). Ferner stellt die Behauptung der Vorinstanz, der Geschädigte hätte die Blockade bald freiwillig aufgegeben, eine blosse Mutmassung dar, die zudem den konkreten Umständen widerspricht und deshalb eine willkürliche Beweiswürdigung darstellt. Die Vorinstanz hätte bezweifeln müssen, ob ihre blosse Vermutung über den baldigen freiwilligen Blockadeabbruch Wettsteins eine sichere Urteilsgrund darstellt. "Der EGMR betrachtet die Unschuldsvermutung sowohl als Regel der Beweiswürdigung als auch als Beweislastregel. Als Beweislastregel ist die Unschuldsvermutung verletzt, wenn der Richter trotz bestehenden Zweifeln schuldig spricht, als Beweiswürdigungsregel, wenn er zwar anicht gezweifelt hat, aber hätte zweifeln müssen." (Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Art 6, Seite 148)
Zu b):
Die Behauptung der Vorinstanz, beim Einsatz des
Pfeffersprays sei mit bedeutenden Verletzungen zu rechnen gewesen, ist eine
blosse Mutmassung, die zudem falsch ist: Die Zusammensetzung von
Pfeffersprays ist darauf ausgerichtet, dass die Gesundheit nicht gefährdet
wird. Darum sind Pfeffersprays ohne Waffenschein erhältlich. Das Urteil
beruht deshalb auf blossen Mutmassen und willkürlicher Beweiswürdigung, dh
Feststellungen, die sich aus der Beweislage nicht ergeben.
Dazu kommt folgender wichtiger, von der Vorinstanz willkürlich nicht
beachteter Sachverhalt: Der BF hat den Geschädigten zuerst mit einem kurzen
Sprayeinsatz, gewarnt, die Blockade aufzugeben. Anstatt aber spätestens
jetzt den Weg freizugeben, ging der Geschädigte gegen den BF vor und
versuchte ihn zu fassen. Diesen Angriffsversuch wehrte der BF - im Unterholz
des eindunkelnden Waldes langsam zurückweichend - mit zusätzlichem
Sprayeinsatz ab. Erst jetzt kam es zu einem bedeutenden Einsatz des
Pfefferssprays, der die diagnostizierte Augenentzündung bewirkt hat. Dass
schon der erste Warnspray ein Augenentzündung bewirkt haben soll, ist
unwahrscheinlich und jedenfalls nicht erwiesen. Sogar der nachfolgende
massive Sprayeinsatz zur Abwehr des Angriffsversuches bewirkte keine schwere
Beeinträchtigung des Geschädigten, sonst hätte dieser nicht schon - nach
eigenen Aussage (siehe Einvernahmeprotokolle) - eine Viertelstunde später im
dunklen Wald heimfahren können. Insofern sich der erst 5 Jahre nach dem
Zwischenfall einvernommene Zeuge P.B. (eine massive Verletzung der
Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6) nicht mehr in allen Einzelheiten daran
erinnern konnte, darf dies nicht zu Ungunsten des BF ausser Acht gelassen
werden.
Zu c):
Dass sich das die Wegfahrt des BF blockierende Auto des Geschädigten mit einem Pfefferspray "nicht von der Fahrbahn entfernen" liess, ist eine geradezu bösartig triviale Argumentation der Vorinstanz. Der BF hat nie behauptet, er habe das Auto mit dem Pfefferspray wegpusten wollen. Vielmehr wollte der BF - für jeden den Sachverhalt ernsthaft beurteilenden Richter einsichtig - den Geschädigten mit dem ersten Warneinsatz des Pfeffersprays damit vertreiben, dh zum Wegfahren veranlassen. Das war offensichtlicher Sinn und Zweck des ersten kurzen Sprayeinsatz. Dieser war, da dadurch keine ernsthafte Beeinträchtigung des Geschädigten bewirkend, angemessen und verhältnismässig und die gegenteilige Behauptung der Vorinstanz stellt eine willkürliche Beweiswürdigung dar.
Eine unvorhergesehene Situation ergab sich erst dadurch, dass der Geschädigte auf den Warnspray nicht wegfuhr, sondern versuchte, den BF anzugreifen, und zwar sehr hartnäckig durch den Nebel des nun anhaltend eingesetzten Pfeffersprays hindurch. Da der Geschädigte nun gar nicht mehr fähig war, sofort wegzufahren, den Autoschlüssel - wie sich nun zeigte - nicht im Auto stecken hatte sondern auf sich trug, war nun ein nicht vorausgesehenes Problem entstanden. Der Schlüssel hätte dem Geschädigten nur mit massiver Gewalt weggenommen werden können, um das Auto wegzustellen. Da der nicht als gewaltbereit bekannte und auch nicht einschlägig vorbestrafte BF dies nicht wollte, ging er das Risiko ein, im Dunklen die Wegfahrt durch den sumpfigen, mit Unterholt überwachsenen Waldweg zu versuchen, was wie durch ein Wunder gelang, mit verdrecktem und zerkratztem Auto.
3.4
Der Kläger hat den BF unbestritten ohne vernünftigen Anlass provoziert, ist ihm zu diesem Zweck in den Wald gefolgt und hat ihn rechtswidrig am Wegfahren gehindert (Vorinstanz Seite 61, 63ff). Diese Situation ergab sich für den BF überraschend. Er war bestürzt über diese von ihm nicht provozierte Eskalation der von ihm nicht gesuchten Auseinandersetzung. Er versuchte in der Aufregung das Bestmögliche zu machen. Dass er sich nach der vorausgegangenen verbalen Provokation auch noch dieser Nötigung einfach hätte widerstandslos auf unbestimmte Zeit beugen sollen, kann ihm weder rechtlich noch ethisch im Ernst vorgehalten werden. Deshalb ist er gemäss dem neuen Artikel 16 Absatz 2 StGB sogar dann nicht schuldhaft, wenn sein Verhalten als objektiv die Notwehrgrenze überschreitend beurteilt würde. (Gemäss Art 2 des revidierten StGB ist dieses auch auf Taten anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten begangen wurden, wenn sie zu einer milderen Beurteilung führen.) Die Vorinstanz hat dies willkürlich ausser acht gelassen und Bundesrecht falsch angewendet. Das vorinstanzliche Urteil ist allein schon aus diesem Grund aufzuheben
3.5
Anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung vom 28. Mai 2003 erklärte der erbetene Verteidiger, dass er zu diesem Anklagepunkt vorläufig nicht plädieren könne, da die Untersuchung nicht abgeschlossen und insbesondere der mehrfach beantragte wichtige Augenzeuge P.B. noch nicht einvernommen worden sei.
Mit Schreiben vom 18. August 2003 teilte der erbetene Verteidiger dem Gericht mit, dass er an der Fortsetzung der Verhandlung vom 3. September 2003 nicht teilnehmen werde, da der Entlastungszeuge P.B. nicht vorgeladen worden sei und er - wie schon am 28. Mai 2003 dargelegt - solange nicht zur Anklage betreffend Körperverletzung plädieren könne.
Die amtliche Verteidigerin wies anlässlich der Fortsetzung der Verhandlung vom 3. September 2003 ebenfalls darauf hin, dass der Zeuge P.B. noch einzuvernehmen sei, beantragte dies formell und begründete dies auch.
Hierauf schloss der Vorsitzende überraschend die Verhandlung, und das Gericht schritt zur Urteilsberatung. Über die mehrfach wiederholten Beweisanträge wurde nicht Beschluss gefasst, weder in einem Zwischenentscheid noch im Endurteil. Damit hat die erste Instanz das rechtliche Gehör verletzt. Indem die Vorinstanz auf diese im Rückweisungsgesuch vorgebrachte Rüge mit keinem Wort einging, hat auch sie das rechtliche Gehör verletzt. Damit ist zu diesem wichtigen Punkt, in dem der Angeklagte verurteilt wurde, von beiden Vorinstanzen das rechtliche Gehör verweigert worden.
Mit Anträgen wird im Sinne von Erwirkungshandlungen die Durchführung behördlicher Prozesshandlungen verlangt. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verlangt, dass die angesprochene Behörde den Antrag prüft und - soweit er zulässig ist - einen materiellen Entscheid darüber trifft und dem Antragsteller mitteilt (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Rz 544).
3.6
Wäre das erstinstanzliche Gericht der Ansicht gewesen, über die Beweisanträge nicht entscheiden zu müssen, hätte es zumindest die Verteidigung unzweideutig darauf aufmerksam machen müssen, dass sie trotzdem zur Sache plädieren müsse. Dies hat das Gericht nicht getan und die Verteidigung im Glauben gelassen, dass über die beantragte Beweisabnahme vor dem Erlass des Urteils entschieden würde.
Wie die Vorinstanz richtig feststellt (Seite 24) hat der erstinstanzliche Vorsitzende die Hauptverhandlung unterbrochen und angekündigt, anlässlich der Fortsetzung der Verhandlung werde auch über die Frage einer allfälligen Beweisergänzung entschieden. In Tat und Wahrheit hat das Gericht dann nie über diese Beweisanträge entschieden.
Mit diesem Verhalten hat die erste Instanz in einer gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (BV 5.3) verstossenden Weise eine wirksame Verteidigung verhindert, obwohl es vom Obergericht angewiesen worden war, die erstinstanzliche Hauptverhandlung mit einer ausreichenden Verteidigung zu wiederholen.
3.7
Von einer Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens i.S. des Beschlusses des Obergerichts vom 20. August 2002 kann aufgrund obiger Ausführungen nicht die Rede sein, da eine wirksame, materielle Verteidigung verhindert wurde und das Gericht sich statt dessen einfach auf das Ergebnis des ersten, vom Obergericht aufgehobenen Verfahrens stützte.
3.8
Gemäss der Praxis des EGMR genügt es nicht, den materiellen Garantien der EMRK bloss formell, dem Anschein nach, Rechnung zu tragen. Den Verteidigungsrechten gemäss Art. 6 EMRK ist durch die blosse Anwesenheit von Verteidigern noch nicht Genüge getan. Der Staat hat - insbesondere im Fall einer als notwendig erkannten Verteidigung - dafür zu sorgen, dass ein Angeklagter effektiv verteidigt wird.
Indem sich der erstinstanzliche Gerichtspräsident während der Verhandlung nicht zur beantragten Zeugeneinvernahme äusserte, einen Entscheid darüber in Aussicht stellte, dann aber nie darüber Beschluss fasste (siehe oben Ziffer 3.6) und die Verteidigung dadurch im Glauben liess, es werde entweder eine Beweisverhandlung mit den beantragten Zeugeneinvernahmen sowie eine Tatortbesichtigung erfolgen oder aber, es werde dieser Antrag abgelehnt, womit die Verteidigung sich auf diese Situation hätte einstellen können, verhinderte die Vorinstanz eine gehörige Verteidigung i.S. des Rückweisungsbeschlusses sowie i.S. von Art. 6 EMRK.
Siehe dazu auch Ziffer 1.3 bis 1.5 und 1.7 bis 1.8
3.9
Um die dargelegten Unterlassung zu rechtfertigen, stellt sich die erste Instanz auf den Standpunkt, der BF habe den Sachverhalt zugegeben (Erw. S. 90 ff., insbesondere S. 93), was aktenwidrig ist. Im Plädoyer zur Hauptverhandlung vom 7. November 2001 hatte der Angeklagte den Sachverhalt ausführlich geschildert und seine Notwehr-Situation dargelegt (Seite 15ff). Darauf ging die erste Instanz willkürlich und unter krasser Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht ein. Statt dessen behauptete sie aktenwidrig (S. 93) - wie ein Vergleich der Zeugeneinvernahme des Geschädigten mit dem Plädoyer des Angeklagten sofort ergibt - die Sachverhaltsschilderungen würden im Wesentlichen übereinstimmen. Stillschweigend - und ohne den einzigen Augenzeugen einvernommen zu haben - unterschlug die erste Instanz die Schilderung der Notwehrsituation durch den Angeklagten und stützte sich einseitig auf die Darstellung des Geschädigten; dies wiederum ohne jede Begründung. Die vom BF geltend gemachte Notwehrsituation wurde mit keinem Wort gewürdigt. Dadurch hat die erste Instanz auch in diesem zentralen, urteilsentscheidenden Punkt das rechtliche Gehör verletzt.
Die erste Instanz beurteilte die Darstellung im erwähnten Plädoyer des BF bezüglich dem versuchten Angriff durch den Geschädigten als "nicht gesichert" (Erw. S. 93). Diese bleibe deshalb unbeachtet, was sich angeblich zum Vorteil des Angeklagten auswirken würde. Die erste Instanz begründete die Unsicherheit des Sachverhaltes damit, der Angeklagte habe anlässlich der Befragung erklärt, Wettstein sei nicht tätlich geworden. Dies ist indessen kein Widerspruch, da der BF dies ja eben gerade mit dem Pfefferspray verhindert hat.
3.10
Der scheinbare Widerspruch zur Aussage des BF vor erster Instanz, er sei nicht tätlich angegriffen worden, wäre leicht zu klären gewesen, wenn der Angeklagte bei der Befragung darauf angesprochen worden wäre, oder durch die Einvernahme des Augenzeugen P.B. Die erste Instanz hat beides pflichtwidrig unterlassen, obwohl sie zu beidem verpflichtet gewesen wäre. Bei unklaren bzw. mehrdeutigen Äusserungen des Angeklagten besteht eine richterliche Fragepflicht, die sich aus der richterlichen Fürsorgepflicht ergibt (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage Rz 245 und Fussnote 291 dazu). Anderseits wäre das Gericht aufgrund des durch EMRK 6 garantierten Rechts auf den Beweis verpflichtet gewesen, den Augenzeugen P.B. durch die Bezirksanwaltschaft (im Rahmen einer Rückweisung) einvernehmen zu lassen oder selber einzuvernehmen. Insgesamt hat die erste Instanz aufgrund von Mutmassungen anstatt pflichtgemässer Zeugeneinvernahme geurteilt (Verletzung des Rechts auf den Beweis, willkürliche Beweiswürdigung, Verurteilung aufgrund von Mutmassungen).
3.11
In seinem schriftlichen Plädoyer vom 7. November 2002 (Seite 15) schilderte der BF die Situation ausführlich, währenddem die kurze Befragung anlässlich der zweiten erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 3. September 2003 - fünf Jahre nach dem Vorfall! - sich auf ein paar pauschale Fragen beschränkte. Das Resultat dieser Befragung benutzte das Gericht als Vorwand, um den Zeugen P.B. nicht einzuvernehmen mit der Begründung, es werde statt dessen zugunsten des Angeklagten angenommen, er habe nur einmal kurz vom Spray Gebrauch gemacht und nicht mehrmals, um den Geschädigten abzuwehren.
Diese Sachverhaltsannahme wirkte sich indessen - entgegen der Behauptung des Gerichtes - in den Urteilserwägungen nicht zu Gunsten des Angeklagten aus. Die dem BF vorgeworfene einfache Körperverletzung ist überhaupt erst dadurch entstanden, dass der Geschädigte nach dem ersten kurzen Warnsprayen - das ihn zum Abbruch der Blockade hätte veranlassen sollen - versuchte, den Angeklagten zu fassen. Erst jetzt kam es zu einem bedeutsamen Sprayeinsatz. Der Angeklagte musste nun, zurück- und ausweichend, massiv vom Selbstverteidigungsspray Gebrauch machen. Erst dies hat zu einer Augenreizung geführt, welche den Tatbestand der einfachen Körperverletzung zu erfüllen vermag. Das Bezirksgericht beachtete diesen Umstand nicht, auch das Obergericht nicht. Die Urteile beider Instanzen beruhen deshalb auf einer willkürlichen Beweiswürdigung (Widerspruch zwischen Beweisgrundlage und Schuldspruch).
Die Vorinstanz hält fest(Seite 66-67), ob es zu diesem nachfolgenden Sprayeinsatz gekommen sei, könne letztlich offen bleiben, da der BF diesfalls in berechtigter Notwehr gehandelt hätte. Im Widerspruch zu dieser Feststellung machte die Vorinstanz den BF jedoch für die Bindehautentzündgung gemäss dem ärztlichen Zeugnis voll verantwortlich, obwohl nicht ohne Willkür angenommen werden kann, diese sei schon durch den ersten, kurzen Warnspray aus grösserer Distanz entstanden (willkürliche Beweiswürdigung und Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw der Begründungspflicht).
3.12
Bei dieser Unsicherheit der Beweislage hätte der BF nach dem Grundsatz in dubio pro reo freigesprochen werden müssen. Diesen Grundsatz hat die Vorinstanz verletzt - eine menschenrechtswidrige Verletzung der Unschuldsvermutung (EMRK 6).
3.13
Das Gericht hätte den scheinbaren Widerspruch gemäss vorstehender Ziffer 2.7 zwischen dem schriftlichen Plädoyer des BF und seiner kurzen Befragung (Jahre später!) nicht ohne einen Versuch zur Klärung dazu missbrauchen dürfen, den Sachverhalt stillschweigend anders zu deuten als vom BF in seinem schriftlichen Plädoyer ausführlich geschildert (Seite 15ff). Dieses Vorgehen gehört zu den durch die Menschenrechtsgarantie auf ein faires Verfahren verpönten Praktiken (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Rz 242a) und verletzt EMRK 6.
3.14
Der erst im Berufungsverfahren angehörte Augenzeuge P.B. konnte sich - fünf Jahre nach dem Vorfall - an diese wichtigen Einzelheiten nicht mehr genau erinnern. Das stellt eine urteilsentscheidende Verweigerung des Rechts auf den Beweis und eine schwerwiegende Verhinderung einer wirksamen Verteidigung dar.
Indem der Kronzeuge P.B. erstmals im Berufungsverfahren vor Obergericht, fünf Minuten vor der Urteilsfällung angehört wurde, wurde eine wirksame Verteidigung verhindert. Die Verteidigung verfügte unter diesen Umständen nicht über die in EMRK 6.3 garantierte Vorbereitungszeit für eine wirksame Verteidigung.
3.15
Betreffend den Zeugen P.B. macht die Vorinstanz auf Seite 11 eine aktenwidrige Feststellung: Die Verteidigung habe kurz vor der Fortsetzung der Berufungsverhandlung widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich (venire contra factum proprium) beantragt, auf die Befragung von P.B. als Zeuge zu verzichten. Dies ist unzutreffend. Der Antrag der Verteidigung lautete nicht so, sondern wie folgt (Schreiben des erbetenen Verteidigers vom 29. September 2004 an das Obergericht):
...beantrage ich, auf diese Einvernahme zu verzichten und den Angeklagten freizusprechen, eventualiter das Verfahren zwecks Einvernahme der Zeugen P.B. und Wettstein an die 1. Instanz zurückzuweisen.
Damit wurde nicht einfach ein Verzicht auf die Einvernahme des Zeugen P.B. beantragt, sondern ein anderes Vorgehen, nämlich einen Freispruch ohne weitere Beweisabnahmen oder Rückweisung an die erste Instanz mit der Auflage, den Zeugen P.B. einzuvernehmen - also etwas ganz anderes, als was die Vorinstanz aktenwidrig behauptet. Aktenwidrigkeit ist ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
3.16
Weil sich der genaue Sachverhalt wegen der krassen Verschleppung der Zeugeneinvernahme im Berufungsverfahren nicht mehr genau feststellen liess, hätte das Obergericht hätte den Angeklagten nach dem Grundsatz in dubio pro reo freisprechen müssen. Statt dessen übernahm das Obergericht von der ersten Instanz die Behauptung (S 66f), die Annahme eines nur einmaligen Spray-Einsatzes wirke sich zu Gunsten des Angeklagten aus, machte ihn dann aber voll für die Augenentzündung des Geschädigten verwantwortlich. Das ist widersprüchlich, und widersprüchliche Urteile sind nichtig. Dass der erste, kurze Sprayeinsatz, von dem das Obergericht angeblich nur ausging, den Geschädigten verletzt haben soll, ist nicht nur nicht belegt, sondern zudem höchst zweifelhaft. Indem das Obergericht den BF dennoch wegen Körperverletzung verurteilte, stellt ein falsches Vorgehen bei der Beweiswürdigung, eine willkürliche Beweiswürdigung und ein Verletzung der Unschuldsvermutung (in dubio pro reo) dar.
3.17
Die dargelegte willkürliche Beweiswürdigung kann niemals die Einvernahme eines Kronzeugen überflüssig machen. Die erste Instanz war sich dessen offensichtlich bewusst und hat wohl deshalb schon gar nicht erst zu begründen versucht, weshalb sie den wiederholten Beweisantrag, den Zeugen P.B. einzuvernehmen, einfach ignorierte. Die aktenwidrige, pauschale Behauptung, die Schilderungen des Angeklagten würden mit den Aussagen des Geschädigten im Wesentlichen übereinstimmen, ist keine verfassungs- und menschenrechtskonforme Urteilsbegründung.
Damit aber verletzt das erstinstanzliche Urteil auch die Begründungspflicht in einem zentralen Punkt, was eine wirksame Verteidigung im Berufungsverfahren unzulässig behinderte.
3.18
Der Angeklagte beantragte die Einvernahme des Zeugen P.B. bereits im Untersuchungsverfahren (Eingabe an die Bezirksanwaltschaft vom 12. Juli 1999) und dann nochmals mit schriftlicher Eingabe an der Hauptverhandlung vom 7. November 2001. Schon die Bezirksanwaltschaft hatte diesen Antrag pflichtwidrig ignoriert und war in Verletzung von § 31 StPO einseitig nur den belastenden Tatsachen nachgegangen. Trotzdem lehnte die erste Instanz den Antrag auf Rückweisung des Verfahrens zur Vervollständigung der Untersuchung an die Bezirksanwaltschaft ab. Als Begründung gab die erste Instanz an, das Gericht könne Beweisergänzungen selber vornehmen (Erw. S. 13), machte das dann aber doch nicht.
3.19
Die Wiederholung der bezirksgerichtlichen Einvernahme des Belastungszeugen Wettstein, verbunden mit der Möglichkeit der Verteidigung, Ergänzungsfragen zu stellen, erfolgte nicht, obwohl
- das Obergericht die Wiederholung der Hauptverhandlung angeordnet hatte,
- der Angeklagte in diesem Anklagepunkt verurteilt wurde,
- dieser Anklagepunkt mit drei Monaten Gefängnis am meisten zum Gesamtstrafmass beitrug,
- die Vorinstanz die Verurteilung entscheidend und einseitig auf die Darstellungen dieses - Belastungszeugen stützte,
- dem Anspruch, Fragen an den Belastungszeugen gemäss BGE 125 I 127 ff "absoluter Charakter" zukommt.
3.20
Bei der Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens wurde der Anklagepunkt der Körperverletzung nicht materiell verhandelt und es wurden keine Zeugen angehört.
Die Vorinstanz stellt zu Recht fest (Seite 33), dass der Angeklagte vor ersters Instanz bezüglich Köprperverletzung nicht materiell verteidigt war. Das Gericht stützte sein Urteil einzig und allein auf das Ergebnis des ersten Verfahrens. Die vom Obergericht angeordnete Wiederholung des Verfahrens fand somit nicht statt, was zu einer erneuten Rückweisung hätte führen müssen. Die Ablehnung des Rückweisungsgesuches durch das Obergericht erfolgte deshalb willkürlich und unter Verletzung der verfassungs- und menschenrechtlichen Garantien eines fairen Verfahrens (EMRK 6) bzw unter nicht verfassungs- und EMRK-konformen Auslegung des Prozessrechtes.
3.21
Der Einwand der Vorinstanz (Seite 33), die fehlende materielle Verteidigung vor erster Instanz sei durch das zweitinstanzliche Verfahren geheilt worden, ist in zweierlei Hinsicht haltlos. Erstens können grundlegende Verletzungen der Verteidigungsrechte, welche eine materielle Verteidigung völlig verhinderten, nicht durch das zweitinstanliche Verfahren geheilt werden, da der Angeklagte gemäss gemäss BV 32 und Praxis des EGMR zu EMRK 6 einen Anspruch auf zwei Instanzen hat. Zweitens war der Angeklagte bezüglich Körperverletztung auch an der Berufungsverhandlung nicht materiell verteidigt. Die Vorinstanz behauptet (Seite 33) unter Hinweis auf das Rückweisungsgesuch das Gegenteil. Die blosse Begründung des Rückweisungsgesuches war indessen keine eigentliche materielle Verteidigung, sondern begründete lediglich die Menschenrechtswidrigkeit der Nichteinvernahme des Kronzeugen P.B. Von einer wirksamen Verteidigung im Sinne von EMRK 6 kann schon deshalb nicht gesprochen werden, weil die Aussagen des Kronzeugen P.B. damals noch gar nicht vorlagen und es lediglich um die Begründung ging, weshalb dessen Einvernahme notwendig sei. Die Vorinstanz behauptet auch an dieser Stelle wieder, eine materielle Verteidigung wäre auch vorgängig der Einvernahme des Zeugen P.B. möglich gewesen - möglich vielleicht schon, aber nicht zumutbar und wirksam:
Indem der Entlastungszeuge P.B. nicht schon antragsgemäss in der Untersuchung einvernommen wurde, ist das Recht auf den Beweis verletzt worden. Diese Menschenrechtswidrigkeit hätte geheilt werden können, wenn die erste Instanz diese Einvernahme nachgeholt und der Verteidigung anschliessend genügend Zeit zur Vorbereitung der Plädoyers gegeben hätte. Indem dies trotz den wiederholten Anträgen der Verteidigung unterlassen wurde, ist diese Menschenrechtsverletzung nicht geheilt worden. Es ist geradezu zynisch, wenn die Vorinstanz die Auffassung vertritt, die Verteidigung hätte sich mit diesem schwerwiegenden Mangel der Untersuchung einfach abfinden und aufs Geratewohl materiell plädieren müssen, ohne zu wissen, was der Kronzeuge dann eventuell später aussagen werde. Es steht ausser Frage, dass der EGMR eine derart krasse Behinderung der Verteidigung in einem Verfahren, wo es um 12 Monate Gefängnis unbedingt ging, niemals billigen wird!
3.22
Verteidigungsrechte sind formelle Rechte, die unabhängig davon zu beachten sind, ob sie einen konkreten Einfluss auf das Urteil haben. Der Rechtfertigungsversuch des Obergericht, die gerichtliche Einvernahme Wettsteins habe kaum Neues gebracht und die Wiederholung der Einvernahme sei nicht nötig gewesen, ist unbehelflich. Die Begründung des Obergerichtes ist grotesk-widersprüchlich: Einerseits erklärt es, diese nicht wiederholte Einvernahme nicht zu verwerten, wertet sie aber dennoch aus zur Feststellung, sie habe kaum Neues gebracht. Damit hat das Obergericht eine menschenrechtswidrige Verletzung der Verteidigungsrechte zu Unrecht geschützt.
3.23
Die Einvernahme des Zeugen Wettstein wurde dann auch im Berufungsverfahren nicht wiederholt. Die Verteidigung hatte keine Möglichkeit, Wettstein mit den Aussagen des Zeugen P.B. zu konfrontieren, was zur Erhellung des Sachverhaltes nötig gewesen wäre, da sich der Zeuge P.B., dessen Einvernahme fünf Jahre lang verschleppt worden war, zwar nicht mehr genau an wichtige Einzelheiten erinnerte, aber immerhin Aussagen machte, die entscheidend von der Sachverhaltsschilderung Wettsteins abweichen und sich mit den Darstellungen des BF decken.
3.24
Der BF ist nicht dafür bekannt, dass er leichtfertig gewalttätig wird. Er ist auch nicht einschlägig vorbestraft. Es hätte ihm deshalb zumindest der bedingte Strafvollzug für den Teil der Gesamtstrafe, der auf das Konto Körperverletzung geht, gewährt werden müssen. Die Verweigerung des bedingten Strafaufschubes erfolgte willkürlich und unter falscher Anwendung von Bundesrecht.
Zusammenfassung betr Körperverletzung
Wie dargelegt, wurden die Verteidigungsrechte im erstinstanzlichen Verfahren derart krass verletzt, dass nicht mehr von einem ordnungsgemässen Verfahren gesprochen werden kann. Der Angeklagte wurde damit der ersten Instanz beraubt was nicht nur BV 32.3, sondern - gemäss ständiger Praxis des EGMR - auch EMRK 6.3 verletzt.
Anstatt diesen schwerwiegenden Verfahrensmangel durch eine erneute Rückweisung zu beseitigen, wurden die Verfahrensmängel im Berufungsverfahren, wo auch keine materielle Verteidigung stattfand, zementiert.
Wo sich der Zeuge P.B., der unter Verletzung der Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 erst fünf Jahre nach dem Zwischenfall einvernommen wurde, nicht mehr genau an alle Einzelheiten erinnern konnte, hat die Vorinstanz Annahmen zu Ungunsten des BF getroffen, die keine objektive Grundlage in der Beweislage finden, obwohl die Vorinstanz widersprüchlich behauptete, die Sachverhaltsunsicherheit zu Gunsten dese BF zu würdigen. Damit hat die Vorinstanz die Beweise willkürlich gewürdigt und den Grundsatz in dubio pro reo verletzt (Verletzung der Unschuldsvermutung gemäss EMRK 6).
Indem der amtlich verteidigte BF im gesamten Verfahren vor erster und zweiter Instanz nicht materiell verteidigt werden konnte, wurden die Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 massiv verletzt.
Karl-Heinz Deschner, in: "Nur Lebendiges schwimmt gegen den Strom""Ein wenig Güte ohne alle Religion taugt tausendmal mehr als alle Religion ohne Güte."
4.1 Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit und Nichtbeachtung der Berufspflicht
4.1.1
Der Beschwerdeführer (BF = Erwin Kessler) bestreitet nicht, dass die inkriminierten Äusserungen scharf formuliert sind und schockieren können. Das war auch die Absicht: wachrütteln und aufmerksam machen, zu welch grauenvollem Tierleid falsche Toleranz gegenüber perversen "religiösen" Riten führt. Ohne Betroffenheit auszulösen ist politische Tierschutzarbeit, insbesondere der Kampf gegen tradierte, tierquälerische Gewohnheiten, nicht wirksam möglich. Zu diesen tradierten Tierquälereien gehört das von den Juden praktizierte betäubungslose Schächten. (Die Moslems akzeptieren grösstenteils die gesetzliche Betäubungsvorschrift und massgebende moslemische Religionsführer erklären, dass die Betäubung vor dem Schächten im Einklang stehe, mit den islamischen Religionsvorschriften Beilagen 12 und 12).
Gemäss Praxis des EGMR sind auch verletzende und schockierende Äusserungen von der Meinungsäusserungsfreiheit geschützt (Villiger, Rz 603). Die Verurteilung des BF verletzt die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit, da alle inkriminierten Sätze im Kontext sachlich begründet sind, für den Leser erkennbar ein tierschützerisches, nicht rassendiskriminierendes Ziel verfolgen und den ständigen jüdischen Desinformationen vom angeblich schmerzlosen Schächten ohne Betäubung die Gegenposition einer der grössten Nutztierschutzorganisationen der Schweiz (Verein gegen Tierfabriken VgT) in pointierter und aufrüttelnder Formulierung entgegensetzt.
In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft muss es erlaubt sein - so auch der Freiburger Ethik- und Philosophie-Professor Jean-Claude Wolf in seinem Buch "Tierethik" -
"die Dummheit und Blindheit, die Unvernunft und die Lasterhaftigkeit der Mehrheit öffentlich anzuprangern. "
Ebenso muss es erlaubt sein, die Blindheit und Unvernunft auch einer Minderheit anzuprangern. Minderheitenschutz ist gut und recht, aber die Mehrheit muss sich auch vor Minderheiten schützen dürfen. Die Religionsfreiheit muss dort ihre Grenzen finden, wo es nicht mehr um den Kerngehalt der Religionsfreiheit - die Glaubensfreiheit -, sondern um ein blosses äusseres Verhalten geht, das von der grossen Mehrheit dieses Landes nach den hier vorherrschenden Wertvorstellungen als unmoralisch und pervers-religiös betrachtet wird.
In dem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen die Schweiz entschiedenen so genannten Mikrowellen-Prozess, wo es um Unlauteren Wettbewerb und das Recht auf freie Meinungsäusserung ging, verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Urteil vom 28. August 1998 die Schweiz wegen Verletzung der EMRK-Garantie auf freie Meinungsäusserung. Die nationalen Entscheide bis hin zum Bundesgericht wurden als menschenrechtswidrig verurteilt. Solche Verurteilungen der Schweiz häufen sich in den letzten Jahren. Dabei sind die vom EGMR seit langem in konstanter Praxis angwendeten Beurteilungskriterien von Menschenrechtsverletzungen sogar für Laien leicht verständlich. Im Mikrowellen-Prozess legte der EGMR das entscheidende Kriterium einmal mehr dar, indem er wörtlich ausführte, welche Frage er sich in solchen Fällen stellt und wonach geurteilt wird: War der Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft notwendig?
Das Adjektiv notwendig iSv. Art. 10 (2) EMRK bedeutet das Vorliegen einer dringenden Notwendigkeit im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.
Wendet man dies auf die vorliegende Inkriminierung tierschützerischer Kritik am grausamen Schächten an, erkennt man die Unverhältnismässigkeit und politische Willkür: Für die auch vom BF grundsätzlich befürwortete Bekämpfung der Rassendiskriminierung ist es sicher nicht notwendig, die berechtigte Kritik am tierquälerischen Verhalten der Schächtjuden mit Gefängnisstrafe zu unterdrücken. Rassendiskriminierung bedeutet eine Diskriminierung aufgrund blosser Vorurteile. Hier geht es jedoch um sachlich begründete und nach allgemeiner Auffassung berechtigte Kritik an Tierquälern. Die inkriminierte Kritik an den Schächtjuden ist sachlich begründet und beschränkt sich auf einen spezifischen, klar abgegrenzten Themenbereich, wie auch das Obergericht in seinem Entscheid zur Parteistellung der Israelitischen Cultusgemeinde vom 16.2.98, Seite 5, festgestellt hat: "Die Anklagesachverhalte kreisen sämtliche um das vom Angeklagten kritisierte Schächten, das nur von einem Teil der Juden praktiziert bzw als Gebot eingehalten wird."
Die inkriminierten Äusserungen, welche im Kontext stets sachlich mit Tierschutzargumenten begründet waren, stellt keine irrationale, auf Vorurteilen basierende, sich lediglich an einer Gruppenzugerhörigkeit orientierende Diskriminierung dar, sondern ist eine differenzierte, wohlbegründete und deshalb für jedermann nachvollziehbare Kritik. Nach ständiger Praxis des EGMR sind auch Äusserungen geschützt, welche schockieren und provozieren. Die Verurteilung hält deshalb den vom EGMR an Menschenrechtseingriffe gestellten Anforderungen nicht stand.
4.1.2
Die jüdischen Speisevorschriften schreiben nicht vor, Fleisch zu essen, sondern schränken den Fleischkonsum ein und machen lediglich für den Fall, das jemand unbedingt Fleisch essen will, Vorschriften. Es geht somit lediglich um die Zubereitung eines nicht lebensnotwendigen Genussmittels, nicht um religiöse Glaubensinhalte. Im übrigen ist die angebliche Vorschrift, Tiere dürften nur ohne Betäubung geschlachtet werden, eine Erfindung von Rabbinern. Die grosse Mehrheit der Juden in der Schweiz halten sich denn auch nicht an dieses Gebot. In der Kritik des BF stehen deshalb differenziert nur die Schächtjuden und diese unterstützende jüdische Organisationen, nicht alle Juden generell, nur weil sie Juden sind!
4.1.3
Gemäss BGE 6S.64/2004 ist Kritik am Verhalten religiöser und ethnischer Volksgruppen erlaubt, wenn die Kritik auf sachlichen Gründen beruht. Dies ist hier durchwegs der Fall: Das Schächten ist objektiv eine äusserst grausame und unnötige Tierquälerei. Die scharfe moralische Verurteilung der Täter durch den BF, Präsident einer grossen nationalen Tierschutzorganisation, war der objektiven Grausamkeit des kritisierten Verhaltens angemessen. Der BF hat nicht eine unabänderliche religiöse oder ethnische Eigenschaft der Schächt-Juden kritisiert, sondern deren Verhalten, das auf freiem, individuellem Willen beruht. Solche Kritik erfüllt den Rassismustatbestand nicht.
4.1.4
Der BF (Erwin Kessler) ist Redaktor der Zeitschriften VgT-Nachrichten und ACUSA-News sowie der VgT-Website www.vgt.ch mit täglichen News.
Das Schächten war in den letzten Jahren landesweit ein kontrovers diskutiertes Tierschutzthema, nicht zuletzt, weil der Bundesrat den Versuch unternahm, das Schächtverbot aufzuheben, was nicht nur auf den geschlossenen Widerstand der Tierschutzorganisationen stiess, sondern zB auch vom Bauernverband und dem Metzgerverband, sowie von der grossen Mehrheit der Kantone abgelehnt wurde (siehe die neue Basler Dissertation von Sybille Horanyi, Das Schächtverbot zwischen Tierschutz und Religion, Seite 21).
Dazu kommt, dass der VgT eine Volksinitiative für ein Importverbot von Schächtfleisch lancierte.
In dieser Situation gehörte es ganz klar zur Berufspflicht des BF, über die ausserordentliche Grausamkeit und Verwerflichkeit des Schächtens kritisch und angriffig zu informieren, diese Unmenschlichkeit moralisch-ethisch zu verurteilen und den ständigen, skrupellos-verlogenden Verharmlosung durch Schächtjuden, der Schächtschnitt sei schmerzlos, energisch entgegenzutreten.
4.1.5
Gemäss BGE 6S.768/1996/rei (Verein gegen Tierfabriken gegen Beat Gross, Stadtpolizei Bern), Erw. 2 c, deckt die Amst- und Berufspflicht auch unwahre Äusserungen. Man kann sich dazu stellen, wie man will; jedenfalls ist das nun mal vom Bundesgericht so festgelegt worden und somit muss dies für alle gelten. Die Missachtung dieser Bundesgerichtspraxis durch die Vorinstanz stellt eine diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit dar (EMRK Artikel 14 iVm Artikel 10).
Die inkriminierten Äusserungen des BF sind indessen nicht unwahr, was die Vorinstanz zu recht auch nicht behauptet hat. Sie sind auch nicht unnötig verletzend, sondern der Grauenhaftigkeit und Unmenschlichkeit des kritisierten Verhaltens angemessen. Die ausserordentliche, perverse Grausamkeit des Schächtens ist durch viele Dokumente belegt, so auch durch die Videoaufnahmen von modernem, jüdischen Schächten in England, welche der BF zu den Akten gegeben hat, aber von den Vorinstanzen offensichtlich völlig unbeachtet geblieben sind.
Weil der BF somit die ihm vorgeworfenen Mediendelikte in Ausübung seiner Berufspflicht beging, ist gar nicht zu prüfen, ob die Anschuldigungen tatbeständlich sind, weil Art 32 StGB gemäss dem zitierten BGE ganz klar vorgehen. Über diese Tatsache kann sich das Gericht nicht ohne Willkür hinwegsetzen. Jede ansich vielleicht einleuchtende Begründung scheitert an dieser Bundesgerichtspraxis. Die Vorinstanz hat diesbezüglich Bundesrecht nicht beachtet und falsch bzw willkürlich überhaupt nicht angewendet.
Im revidierten StGB wurde die Rechtfertigung durch Amts- oder Berufspflicht abgeschafft. Es erübrigt sich deshalb, die in der Tat befremdliche Bundesgerichtspraxis umstossen zu wollen. Im vorliegenden Verfahren gilt diese jedoch noch.
4.1.6
Wie schon die erste Instanz auf S. 42 ihrer Erwägungen festhält, geht es im vorliegenden Verfahren teilweise um das Zitieren von Aussagen zum Schächten (rituelles Schlachten von Kühen, Kälbern und Schafen bei vollem Bewusstsein, ohne vorherige Betäubung), wegen denen der BF im sog. 1. Schächtprozess verurteilt wurde (Urteil des Obergerichts vom 10. März 1998). Sowohl die Urteilsbegründung als auch die Strafzumessung bauen wesentlich auf jenes Urteil auf, gegen das seit dem 18. November 2000 eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hängig ist und demnächst zur Entscheidung gelangt (siehe die erstinstanzlichen Beilagen 6 und 7).
4.1.7
Der EGMR hat schon einmal eine Menschenrechtsbeschwerde des BF gegen die Schweiz gutgeheissen. Eine zweite steht kurz vor der Gutheissung. Und die Beschwerde gegen die Verurteilung im 1. Schächtprozess wird mit grosser Wahrscheinlichkeit die dritte gutgeheissene Menschenrechtsbeschwerde werden. Sowenig sind Urteile unseres Bundesgerichtes wert, wenn es um Menschenrechtsfragen geht. In der allgemeinen Rassismushysterie ist die gemäss EGMR für jede demokratische Gesellschaft grundlegende Meinungsäusserungsfreiheit völlig marginalisiert worden. Es sind nur noch Äusserungen erlaubt, welche jüdische Kreise nicht stören. Da wird sogar ein Tierschützer mit Gefängnis terrorisiert, nur weil er perverse Tierquäler mit passenden und der Schwere dieser Tierquälerei angemessenen Formulierungen kritisiert hat, wie es seine menschliche und berufliche Pflicht ist.
4.1.8
Da rassendiskriminierendes Denken dem BF (Erwin Kessler) eben gerade fremd ist, kritisiert er Tierquäler unbesehen ihrer gesellschaftlichen Stellung, politischen Macht und Partei- und Religionszugehörigkeit. Völlig korrekt kritisiert er wo nötig auch jüdische Tierquäler, was ihm die Vorinstanz - völlig absurd - als rassendiskriminierend ausgelegt hat. Die gegenwärtige politisch motivierte Gerichtspraxis stellt einen Rückfall in inquisitorische Zustände dar.
4.1.9
Dass in der heutigen angeblich aufgeklärten Zeit ein spezieller Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte nötig ist und in der Arbeit ertrinkt, ist eine bedenkliche Tatsache. Wegen der hoffnungslosen Überlastung tritt der EGMR nur auf rund 5% aller Beschwerden überhaupt ein. Immer wieder wird auch die Schweiz wegen Verletzung der Menschenrechte verurteilt. Dass 95% aller Beschwerden unter dem Titel "unzulässig", in Tat und Wahrheit aber wegen Arbeitsüberlastung, abgewiesen werden (Prof Riklin hat dies zu Recht als "verlogene Praxis" bezeichnet), lässt die Dunkelziffer der Menschenrechtsverletzung auch durch die Justiz der "Musterdemokratie" Schweiz erahnen.
4.1.10
Dass die EGMR-Beschwerde des BF die Zulassungshürde genommen hat, zeigt das Interesse, welches der EGMR dieser Verurteilung wegen sachlich begründeten Äusserungen in einer landesweiten, die Öffentlichkeit stark bewegenden Tierschutz-Diskussion beimisst. Das Vorhaben des Bundesrates, das Schächtverbot aufzuheben, hat eine öffentliche Diskussion ausgelöst, wobei den Informationen und Stellungnahmen des BF - ein prominenter Tierschützer - eine entscheidende Bedeutung zukam.
4.1.11
In einem solchen Umfeld misst der EGMR Einschränkungen der Pressefreiheit eine fundamentale Bedeutung bei und hält Eingriffe nur unter sehr restriktiven Bedingungen für zulässig. "Zusammen mit dem Recht auf Leben und dem Verbot der Folter steht das Recht auf freie Meinungsäusserung hierarchisch an der Spitze des Grundrechtssystems: Denn ohne freie Meinungsäusserung können andere Grundrechte nicht verteidigt werden.... Der Gerichtshof unterstrich diese Bedeutung, als er ausführte: 'Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for the development of every man and woman.' Entsprechend der zentralen Position von Art 10 EMRK werden diese Rechte weit gefasst. Geschützt werden nicht nur einzelne oder bestimmte Informationen. Art. 10 umfasst auch unangenehme Inhalte, die 'offend, shock or disturb'" (Villiger, Rz 603).
4.1.12
Der Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit durch die vorinstanzliche Verurteilung ist schwerwiegend, weil damit in die politische Diskussion über ein Thema von erheblichem öffentlichen Interesse eingegriffen wird (Tierschutz hat Verfassungsrang).
Die Reduktion der Menschlichkeit auf blosse Mitmenschlichkeit, unter Ausschluss der nichtmenschlichen Mitgeschöpfe, ist Ausdruck von Egoismus, nicht von echter Humanität. Das Schächten ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diesem Verbrechen mit passenden Worten entgegenzutreten ist das Mindeste, was getan werden muss, solange noch tonnenweise jüdisches Schächtfleisch für den Konsume in der Schweiz importiert wird. Auf welcher Seite der Landesgrenze diese Tiere geschächtet werden, ist aus tierschützerischer Sicht unerheblich. Der BF setzt sich deshalb nicht nur für eine Beibehaltung des Schächtverbotes ein, sondern auch für ein Importverbot von Schächtfleisch.
4.1.13
Dazu kommt, dass vom vorinstanzlichen Urteil unmittelbar auch die Medienfreiheit betroffen ist, denn der Angeklagte hat sämtliche inkriminiereten Äusserungen als hauptverantwortlicher Redaktor in den Medien des Vereins gegen Tierfabriken (Zeitschrift "VgT-Nachrichten" und VgT-Website www.vgt.ch mit Tages-News und Newsletter) veröffentlicht, klar ersichtlich als Beitrag zur Schächtdiskussion und keinesfalls als private oder pauschale Äusserungen "gegen Juden".
4.1.14
Auch die sog "Meinungspresse", die eine bestimmte politische Richtung oder Weltanschauung vertritt, gehört zur Presse und untersteht der Medienfreiheit. Der Staat darf eben gerade nicht, wie dies die Vorinstanz bundes- und menschenrechtswidrig tat, unbequemen, kritischen Medien die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit entziehen. Indem die Vorinstanz den BF wegen seiner Kritik am Schächten und an den Schächtjuden zu Gefängnis verurteilte, hat sie die Meinungsäusserungs- und Medienfreiheit (BV 17, EMRK 10) verletzt.
4.1.15 ..
4.1.16
Zum Vorwurf angeblich rassendiskriminierender Äusserungen hat die Vorinstanz einige bemerkenswerte Erwägungen angestellt (Hervorhebungen nicht im Original):
Es ist wohl unstrittig, dass das Schächten die politische Diskussion unseres Landes beherrschte und Gegenstand grösster Kontroversen war. In einer solchen Debatte pointiert Stellung zu nehmen lag im Interesse der politischen Meinungsbildung. Dabei darf für die Beurteilung keine Rolle spielen, ob wir eine solche pointierte Stellungnahme materiell als falsch oder als richtig, als zutreffend oder als übertrieben betrachten.... In der politischen Diskussion und Meinungsbildung muss es möglich sein, alle relevanten Standpunkte, auch wenn sie religiöse Organisationen betreffen, zur Sprache zu bringen. Bestünde die Tendenz, alle Kritik, welche den Grenzbereich zwischen Politik und Religion berühren könnte, in die Nähe der Rassendiskriminierung zu rücken, würde ein Segment, ein Element der politischen Willensbildung ausgeschlossen. Das wäre auch für die religiösen Gemeinschaften und Organisationen selber kontraproduktiv. Unterdrückte Kritik findet, früher oder später, immer ein Ventil, um gehört zu werden... Hinsichtlich der objektiven Seite der Tatbestandserfüllung ist festzuhalten, dass der Angeklagte vom Wortlaut der inkriminierten Äusserungen her seine Vorwürfe nur gegenüber den schächtenden Juden, nie aber gegenüber den Juden als Gesamtheit erhoben hat. Freilich ist nicht entscheidend, welche Worte genau jemand wählt. Bedeutsam ist vielmehr der beim Publikum erweckte Eindruck. Ob im vorliegenden Fall das Publikum die Ausführungen als Beleidigung auch der Juden als Ganzes verstehen konnte, ist aber eher fraglich. Die Beantwortung dieser Frage halten wir aber nicht als entscheidend, weil wir hinsichtlich der subjektiven Seite der Tatbestandserfüllung der Auffassung sind, dass ein strafrechtlich relevantes Handeln nicht vorliege, zumindest aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht bewiesen werden könne.
Man muss sich fragen, warum das Gericht dennoch zu einem Schuldspruch gekommen ist. Die Antwort ist einfach. Obiger Text ist nicht dem vorinstanzlichen Urteil entnommen, sondern - mit ganz wenigen Änderungen (kursiv hervorgehoben) - der Rede des Kommissionspräsidenten im Ständerat bei der Beratung über die Aufhebung der politischen Immunität von (damals noch) Nationalrat Blocher wegen Rassendiskriminierung (Beilage 7). Die Argumentation trifft genausogut auf die vorligende Verurteilung des BF zu. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass der BF nicht Christoph Blocher ist und einige vor dem Gesetz etwas gleicher sind als andere.
Während der Kommissionssprecher im Ständerat als wichtig hervorhob, dass Christoph Blocher nicht die Juden als Gesamtheit, sondern nur bestimmte jüdische Kreise kritisiert habe, argumentierten die beiden Vorinstanzen vorliegend gerade um 180 Grad umgekehrt: Es komme nicht darauf an, dass sich die Kritik des BF nicht gegen die Juden als Gesamtheit, sondern nur gegen die Schächtjuden richte; jede jüdische Gruppierung sei geschützt. Diese Rechtsauffassung widerspricht nicht nur der Auffassung des Ständerates, sondern auch der Botschaft des Bundesrates und der gesamten Rechtsliteratur zum Antirassismusgesetz. Das vorinstanzliche Urteil ist wegen Widersprüchlichkeit aufzuheben.
4.2 Bundesrechtswidrige, willkürliche Auslegung des Tatbestand-Merkmals "wegen ihrer Rasse..."
4.2.1
Der BF wurde gestützt auf Artikel 261bis Abs 4 StGB wegen angeblich rassendiskriminierenden Äusserungen verurteilt. Gemäss dieser Strafnorm liegt verbotene Rassendiskriminierung ganz klar nur vor, wenn "eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion ... herabgesetzt oder diskriminiert..." wird. Die Vorinstanz hat das Tatbestandsmerkmal "wegen ihrer Rasse..." nicht beachtet und damit Bundesrecht krass falsch und willkürlich ausgelegt.
4.2.2
Das vorinstanzliche Urteil setzt sich ohne jede Begründung (Verletzung der Begründungspflicht) über die plausible Auslegung von 261bis StGB im "Kurzkommentar des Schweizerischen Strafgesetzbuches" von Stefan Trechsel (2. Auflage) hinweg, obwohl es sich hierbei um ein weit verbreitetes Standardwerk des Schweizerischen Strafrechts handelt. Darin heisst es:
"Die Menschenwürde ist verletzt, wenn dem Opfer seine Existenzberechtigung als Mensch abgesprochen wird wegen einer Eigenschaft, die ohne sein Zutun Bestand hat."
Diese Voraussetzung ist hinsichtlich des Schächtens ohne Betäubung offensichtlich nicht erfüllt: Kein Jude wird von den jüdischen Religionsvorschriften gezwungen, Schächtfleisch zu essen, da die jüdischen Religionsvorschriften nicht vorschreiben, überhaupt Fleisch zu essen, sondern das Fleischessen vielmehr einschränken. Das Talmud-Gebot, kein Blut zu essen, ist primär als Aufforderung zu verstehen, kein Fleisch zu essen, aber wenn schon, dann optimal ausgeblutet. Das von Rabbinern erfundene Schächtgebot wird aus dieser Talmud-Vorschrift abgeleitet und entbehrt angesichts der heutigen Schlacht- und Fleischverarbeitungsmethoden, welche eine optimale Entblutung ohne Tierquälerei sicherstellen, jeder vernünftigen Grundlage. Deshalb hält sich nur eine kleine Minderheit der Juden heute noch diese sinnlose, tierquälerische Koscherregel. Mit Religion hat diese blosse Speiseregel ohnehin nichts zu tun.
4.2.3
Da keinem Juden, auch dem strenggläubigsten nicht, von seiner Religion vorgeschrieben wird, Fleisch zu essen, entscheidet sich jedes jüdische Individuum freiwillig zu dieser Tierquälerei, durch einen freien individuellen Entschluss. Kritik an diesem tierquälerischen Verhalten richtet sich deshalb ganz offensichtlich nicht gegen eine "Eigenschaft, die ohne sein Zutun Bestand hat" . Die inkriminierte Kritik des BF an den Schächtjuden richtet sich nicht gegen eine Eigenschaft, sondern gegen ein Verhalten, für das die Schächtjuden höchstpersönlich und je individuell selber verantwortlich sind. Die Vorinstanz hat diesen entscheidenden Umstand nicht beachtet und die Rassismusstrafnorm deshalb bundesrechtswidrig qualifiziert unrichtig und damit willkürlich ausgelegt.
4.2.4
Im Buch "Die Würde der Kreatur - Erläuterungen zu einem neuen Verfassungsbegriff am Beispiel des Tieres" des bekannten Ethikers Prof Gotthard Teutsch schreibt Rechtsanwalt Dr Antoine Goetschel, ehemaliges Mitglied der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich:
Zu den Pflichten gegenüber Tieren als Ausdruck der Menschenwürde bemerkt Robert Spaemann, er verstehe die Menschenwürde als Fähigkeit und Freiheit des Menschen, auf Angenehmes, Nützliches oder Profitables zu verzichten, weil es einem anderen Wesen schadet oder Schmerzen zufügt...
Das ist genau die Auffassung des BF, weshalb er Schächtjuden, welche lediglich um eines kulinarischen Genusses willen Tiere bestialisch umbringen oder umbringen lassen, anstatt auf den Genuss von Fleisch zu verzichten, die Menschenwürde ab. Dass er dafür ins Gefängnis muss, ist politische Justizwillkür (willkürliche Beweiswürdigung und Rechtsbeugung).
4.2.5
In der Einleitung (Seite 5) zur Botschaft des Bundesrates zum Rassismus-Artikel heisst es:
Verpönt sind nur solche Diskriminierungen, die einzig und allein auf der Unterschiedlichkeit der rassischen oder ethnischen Herkunft beruhen und sich auf keine sachlichen Gründe stützen.
4.2.6
Günter Stratenwerth, "Schweizerisches Strafrecht"(Besonderer Teil II, Auflage 4, Seite 169):
... dass das Verbot der Diskriminierung, wie schon der Gleichheitssatz als solcher, immer nur auf die unberechtigte Zurücksetzung der betroffenen Person bezogen werden kann.
4.2.7
Rassistisch im Sinne des Gesetzes sind also nur unberechtigte Vorwürfe, über deren Berechtigung schon gar keine Diskussion mehr möglich ist, weil sie keinerlei Sachbezogenheit aufweisen und sich allein auf Vorurteile und unhaltbare Verallgemeinerungen stützen. Von einer solchen Situation ist die inkriminierte sachlich begründete Schächtkritik, trotz ihrer Schärfe, Lichtjahre entfernt. Die Vorinstanzen haben sich hartnäckig geweigert, zu prüfen, wie schlimm das Schächten ist, und unbesehen behauptet, die Schächtkritik des Angeklagten sei zu scharf. Eine solche auf Vorurteile und Mutmassungen anstatt auf Sachverhaltsabklärungen beruhende Verurteilung stellte eine unhaltbare, willkürliche Würdigung der Umstände dar.
4.2.8
Bezirks- und Obergericht haben sich willkürlich darüber hinweggesetzt, dass das Strafrecht nicht das Absprechen der Menschenwürde schlechthin verbietet, sondern nur wenn dies in diskriminierender Weise allein wegen der Rasse- oder Religions-Zugehörigkeit erfolgt. Nichts liegt dem BF ferner, als jemanden wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Religion zu diskriminieren. Hingegen macht er Menschen verantwortlich für das was sie tun, bzw Mitgeschöpfen antun. Der BF hat die Schächt-Juden nie wegen ihrer Religionszugehörigkeit kritisiert, sondern ausschliesslich wegen ihrem pervers-tierquälerischen Verhalten. Bezirks- und Obergericht haben sich willkürlich über diese Tatsache hinweggesetzt.
4.2.9
Die Willkür der vorinstanzlichen Rechtsverdrehung zeigt sich auch daran, dass sie krass der Botschaft zur Rassismusstrafnorm des Bundeserates an Volk und Parlament und den entsprechenden Rechtskommentaren entgegenläuft. Obwohl die Stimmbürger im Vorfeld der Volksabstimmung über den Rassismus-Artikel vom Bundesrat massiv angelogen wurden, erfolgte nur eine knappe Zustimmung. Und nachdem es sich nun deutlich gezeigt hat, wie dieser Artikel als Maulkorb-Gesetz gegen nonkonformistische Minderheiten eingesetzt wird, ist ein wachsender Unmut in der Bevölkerung festzustellen, und im Parlament fordert zur Zeit eine beachtliche Minderheit erneut die Abschaffung dieses missbrauchbaren und missbrauchten Maulkorbartikels.
Die Einseitigkeit und der Missbrauch dieses diskriminierenden, Juden einseitig begünstigenden Maulkorb-Strafartikels hat zur Folge, dass ein wachsender, vorher nicht existierender Antisemitismus zu beobachten ist. Nicht der BF ist es, der Antisemitismus fördert, sondern verantwortungslose, fanatische Politiker und Richter, welche das Recht verdrehen, sobald es um jüdische Interessen geht.
4.2.10
Die über den Wortlaut weit hinausgehende, menschenrechtswidrige Auslegung des Rassismus-Artikels, welche diesen zu einem völlig unberechenbaren Maulkorb-Artikel machtt, wie die Abstimmungsgegner im voraus klar erkannt und weite Teile der Bevölkerung geahnt haben, beweist dessen Unbestimmtheit. Nur ein Gummiartikel kann derart überdehnt und missbraucht werden. Dadurch wird das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot in menschenrechtswidriger Weise verletzt.
4.2.11
Liest man die inkriminierten Äusserungen im Zusammenhang und nicht bloss aus dem Zusammenhang gerissen, ist es abwegig zu behaupten, die Kritik an den Schächtjuden erfolge wegen der Zugehörigkeit zum Judentum. Dass der BF die Schächtjuden wegen ihrer Tierquälerei, nicht wegen ihrer Religionszugerhörigkeit kritisierte, war für die Leser der inkriminierten Veröffentlichungen klar ersichtlich.
4.2.12
Nach Niggli, Kommentar zur Rassendiskriminierung, (N 748), liegt Rassismus dann vor,
...wenn der Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt wird, dass eine Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund an den Kriterien der Rasse, Ethnie oder Religion anknüpft.
Die inkriminierten Äusserungen haben einen für jedermann ersichtlichen sachlichen Grund: Tierquälerei. Jemandem aufgrund bestialischer Tierquälerei Unmenschlichkeit vorzuwerfen, kann sicher nicht als unberechtigte Zurücksetzung ohne sachlichen Grund qualifiziert werden.
4.2.13
Nach Robert Rom, "Die Behandlung der Rassendiskriminierung im schweizerischen Strafrecht", Dissertation Uni Zürich, (Seiten 9-12) versteht man unter Rassismus
die Ideologie der Überlegenheit einer oder mehrerer Rassen bzw die Unterlegenheit und Minderwertigkeit anderer Rassen. Diese Ideologie entspringt dem Glauben, dass die überlegene Rasse sich durch unveränderbare biologische, physische, charakterliche oder kulturelle Eigenschaften von anderen Rassen abhebe.
Rassendiskriminierung... äussert sich in einer willkürlichen, dh unsachlichen und ungerechten Ungleichbehandlung von Personen oder Personengruppen allein aufgrund ihrer Rasse und unabhängig von deren tatsächlichen Verhalten oder sachlichen, gerechtfertigten Kriterien. Ziel der Ungleichbehandlung ist die Herabsetzung, Zurücksetzung und Benachteiligung.
Die inkriminierten Veröffentlichungen zum Thema Schächten haben nichts mit dem strafrechtlichen Rassismus-Begriff zu tun. Die Kritik des BF ist zwar scharf, aber für jedermann erkennbar sachlich begründet, unabhängig davon, ob er seine Beurteilungen teilt und seine Vergleiche für passend hält oder nicht. Es ist grotesk, in der Bezeichnung von Tierquälern als Unmenschen eine Rassendiskriminierung sehen zu wollen.
4.2.14
Auch mit folgendem Zitat aus der Botschaft des Bundesrates (Seite 46) haben sich die Vorinstanzen nicht auseinandergesetzt (Verweigerung des rechtlichen Gehörs):
Die Gefährdung des geschützten Rechtsgutes liegt in der Unentrinnbarkeit der Kriterien, da sich diese jeder Bemühung um Intergrierung entziehen. Seiner Abstammung kann ein Mensch sich nicht entledigen.
Das ist im Zusammenhang mit dem Schächten gerade nicht der Fall. Jeder Jude, auch der ultraorthodoxeste, kann dem Unmenschlichkeits-Vorwurf wegen des Schächtens sehr leicht "entrinnen", indem er sich vegetarisch ernährt. Das wäre erst noch eine gesündere und preisgünstigere Ernährung, also sicher nichts Unzumutbares. Die jüdische Religion schreibt nicht vor, es müsse Fleisch gegessen werden.
Insgesamt ist das Tatbestandsmerkmal "wegen ihrer Rasse..." bei allen inkriminierten Äusserungen nicht erfüllt und die vorinstanzliche Auslegung der Rassismusstrafnorm qualifiziert unrichtig und willkürlich.
4.3 Bundesrechtswidrige, willkürliche Auslegung des Tatbestandsmerkmals "eine Gruppe von Personen"
4.3.1
Nach Rehberg, Strafrecht Bd IV, (Zweite Auflage, S 182,) kann von einer religiösen Gruppe im Sinne der Rassismus-Strafnorm nur gesprochen werden, wenn
sich die Angehörigen der Religion selber als Gruppe empfinden und diese auch von der übrigen Bevölkerung als solche aufgefasst wird.
4.3.2
Im gleichen Sinne auch Niggli, Rassendiskriminierung (Kommentar zum Art 261bis StGB, N 342 ff) wonach eine Gruppe im Sinne des Gesetzes folgende Eigenschaften hat, die sie von anderen Gruppen wie Gesellschaften, Clubs, Mitglieder einer Berufsgattung, Studenten einer bestimmten Universität und anderen blossen Interessengemeinschaften unterscheiden:
Gruppen sind nach allgemeinem Konsens Grössen, die nicht einfach Aggregate oder Ansammlungen von Individuen repräsentieren, sondern soziale Grössen mit eigener Identität darstellen, wobei sich die Gruppenmitglieder einander zugehörig fühlen und bis zu einem gewissen Grad an ihre Mitgliedschaft in der Gruppe unveränderlich gebunden sind...
Diese Unveränderlichkeit ist eng verknüpft mit der Vorstellung von "angeboren"...
4.3.3
Diese Gruppendefinition mag auf die Juden insgesamt oder auf die orthodoxen Juden zutreffen, aber sicher nicht auf die Juden, welche Schächtfleisch essen. Es gibt Juden, die ausschliesslich Koscherfleisch essen und solche, die sowohl normales Fleisch wie auch Koscherfleisch essen und solche die überhaupt kein Fleisch essen. Die Schächtfleisch-essenden Juden bilden keine abgegrenzte Gruppe, sind nach aussen hin nicht als Gruppe erkennbar und haben nicht einmal einen Gruppennamen und erfüllen deshalb die Kriterien an eine geschützte Gruppe im Sinne von Art 261bis StGB offensichtlich nicht. Insbesondere sind die Schächtjuden nicht mit den orthodoxen Juden identisch, auch nicht mit den ultraorthodoxen, denn auch unter diesen gibt es Vegetarier, die von den inkriminierten Äusserungen des BF nicht betroffen sind. Alle inkriminierten Äusserungen richten sich, wie dem Leser aufgrund des Kontextes klar ist, nicht gegen die Juden allgemein, sondern nur gegen die schächtenden und Schächtfleisch-essenden, welche - mangels einer offiziellen bzw üblichen Bezeichnung - vom BF behelfsmässig als "Schächtjuden" bezeichnet werden.
Dazu kommt das Kriterium der Unveränderlichkeit: Dieses ist für die Anhänger des Schächtens ganz sicher nicht erfüllt. Der Verzicht auf die ohnehin nicht gesunde Fleischnahrung reicht bereits, um nicht mehr zu dieser Gruppe zu gehören. Selbst der orthodoxeste aller orthodoxen Juden steht im Einklang mit der strengsten Auslegung jüdischer Religionsvorschriften, wenn er sich vegetarisch ernährt.
4.3.4
Nach Niggli
muss die Gruppe etwas Unabhängiges von ihren Mitgliedern darstellen, die sie konstitutionieren, mithin eine selbständige Grösse mit eigener Identität (N 357)
und
Massgebendes Kriterium muss die gesellschaftliche Existenz einer "Gruppe" als Eigenständiges, Benennbares sein (N469).
Auch diese Definition trifft auf die Schächt-Anhänger (Schächt-Juden) offensichtlich nicht zu.
4.3.5
Nach Niggli (N 459) umfasst der Begriff der Religion eine
Gesamtsicht der Welt..., ein eigentliches Glaubenssystem.
Die Europäische Menschenrechtskommission hat denn auch beim Wunsch, auf dem eigenen Grundstück beerdigt zu werden, die Religionsausübung verneint, da dieser Wunsch nicht "Ausdruck einer zusammenhängenden Sicht grundlegender Probleme" darstellt.
Der Wunsch, geschächtetes Fleisch zu essen, ist analog zu diesem Präjudizfall. Dabei ist wichtig zu sehen, dass das Essen von Schächt-Fleisch kein vorgeschriebenes religiöses Ritual (Ritus, Kult), dh keine Kultushandlung, sondern eine blosse Speiseregel ist. Laut dem auf Tierschutzrecht spezialisierten Rechtsanwalt Goetschel (ehemals Mitglied der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich ist das Schächten keine Kultushandlung, da es sich bei dem vor dem Schächtschnitt ausgesprochenen Segensspruch nicht um einen Akt der Gottesverehrung handelt; im jüdischen Leben würden häufig Segensformeln in Zusammenhängen gesprochen, die offensichtlich nicht eigentlich gottesdienstlichen Charakter hätten (zitiert nach Horanyi, Das Schächtverbot zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit, Seite 57).
Die koscheren Speiseregeln sind eben blosse Speiseregeln und besagen lediglich, wie Fleisch gewonnen werden soll für diejenigen, die auf Fleischgenuss nicht verzichten wollen. Rituale dagegen sind traditionsbestimmte Handlungsweisen ohne bewussten Zweckbezug (Meyers Enzyklopädisches Lexikon).
4.3.6
Das Merkmal des Schächtens begründet also ganz klar keine Religion im Sinne des Rassismus-Artikels.
4.3.7
Vergleicht man nun die inkriminierten Äusserungen des BF, die ihm als rassendiskriminierend vorgeworfen werden, so kann beim besten Willen nicht erkannt werden, inwiefern diese rassendiskriminierend im Sinne des Gesetzes sein sollen. Die Vorinstanz hatdas Tatbestandskriterium "eine Gruppe von Personen wegen ihrer Religion, Ethnie oder Rasse" völlig falsch und damit auch willkürlich ausgelegt.
4.4 Willkürliche Beweiswürdigung
4.4.1
Die angebliche Verletzung des Rassendiskriminierungsverbotes durch Veröffentlichung des Gerichtsprotokolls Graf wird in Kapitel 5 behandelt; es geht dabei nicht um Äusserungen des BF (Erwin Kessler), sondern um Äusserungen des Gerichtsschreibers des Bezirksgerichtsgerichtes Baden und der unbestritten wahrheitsgetreuen und ausgewogenen Zusammenfassung der Verhandlung durch den Gerichtsberichterstatter Xaver Merz .
Bei allen angeblich rassendiskriminierenden Äusserung des BF geht es ausschliesslich um das betäubungslose Schächten; der BF (Erwin Kessler) hat sich nicht in anderem Zusammenhang herabwürdigend über Juden geäussert. Die moralische Verurteilung der Schächtjuden - dh der kleinen jüdischen Minderheit der Schächtbefürworter und Koscherfleisch-Esser - hat der BF stets mit der ausserordentlichen Grausamkeit des Schächtens, also mit sachlichen Argumenten begründet. Nie hat sich der BF pauschal und undifferenziert negativ über Juden geäussert. Dieser Umstand ist von der Vorinstanz überhaupt nicht gewürdigt worden. Das stellt eine willkürlich einseitige Beweiswürdigung dar.
4.4.2
Die Vorinstanz hat die inkriminierten Äusserungen über das Schächten und über Schächtjuden völlig isoliert, aus dem sachlichen Zusammenhang gerissen, beurteilt, ohne Beachtung des Kontextes. Auch das stellt eine willkürliche Beweiswürdigung dar, denn bekanntlich wird der Sinn einzelner Sätze aus einem Text entscheidend durch den Textzusammenhang bestimmt.
4.4.3
Willkürlich ausser acht gelassen wurde auch der Umstand, dass die inkriminierten Veröffentlichungen nicht in irgendwelchen Medien erschienen sind, sondern ausschliesslich in den VgT-Medien (Zeitschrift VgT-Nachrichten und VgT-Website) und als Teil einer ganzen Serie zum Schächten. Die inkriminierten isolierten Sätze waren nicht nur eingebettet in den jeweiligen unmittelbaren Kontext, sondern auch in die Abfolge der Veröffentlichungen zum Thema Schächten in diesen Medien. Für den unbefangenen Leser kann kein Zweifel daran bestehen, dass es dem BF ausschliesslich um das Tierschutzthema Schächten geht und nicht um Antisemitismus. Auch dieser Umstand wurde willkürlich nicht gewürdigt.
4.4.4
Insgesamt liegt der Verurteilung wegen angeblich rassendiskriminierenden Äusserungen zum Thema Schächten eine mutwillige Entkontextualisierung der inkriminierten Sätze vor, dh eine willkürliche Beweiswürdigung.
4.4.5
Auch die Gerichte sollten endlich zur Kenntnis nehmen, dass nicht jede - auch scharfe - Kritik an jüdischem Verhalten mit Antisemitismus gleichzusetzen ist.
4.5 Menschenrechtswidrige Anklageschrift / Verletzung des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebotes
4.5.1
Art. 261bis StGB genügt schon selber den Bestimmtheitsanforderungen, welche an die Umschreibung eines Straftatbestandes gestellt werden müssen, nicht (ZStrR Band 109 [1992] S. 154 ff, und Entscheid EGMR vom 16. Februar 2000, S. 17 Ziff. 55 ff., B4).
4.5.2
Die Tatbestandsdarstellung in Art. 261bis StGB gibt dem Rechtsunterworfenen keine klare Auskunft, welche Verhalten erlaubt und welche unerlaubt sind. Umso strengere Anforderungen sind bezüglich Konkretisierung von Sachverhalt und strafrechtlichem Vorwurf an eine Anklageschrift zu stellen, welche die Bestrafung eines Angeklagten gestützt auf Art. 261bis zum Zwecke hat - mehr noch, wenn diese Person, wie im Falle des BF, zu einer unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt wird.
4.5.3
Die Nachtragsanklage vom 28. April 2003 (DG020100, act. 15/8) erfüllt weder die Anforderungen von § 162 StPO noch diejenigen von EMRK Art. 6 Ziff. 3a. Letzterer fordert, dass der Angeklagte "...in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Kenntnis gesetzt wird". Um eine wirksame Verteidigung aufbauen zu können, ist klar, dass diese Einzelheiten selbstverständlich vor der ersten Gerichtsverhandlung dem Angeklagten und seinem Verteidiger bekannt sein müssen.
4.5.4
Die Nachtragsanklage vom 28. April 2003 genügt diesen Anforderungen nicht: Welche strafrechtlich relevanten Ideologien verbreitet der Angeklagte (act. 15/8 S. 2 ff)? Welchen Inhaltes? Gegen welche (Zitat) "Rasse, Ethnie oder Religion" soll sich die behauptete Ideologie des Angeklagten richten? Worin sieht die Bezirksanwaltschaft die "gegen die Menschenwürde verstossende Weise", welche sie dem Angeklagten vorwirft? Inwieweit handelt es sich um Wiederholungen von Äusserungen (act. 15/8 S. 2 unteres Drittel). Zudem berief sich die Anklage fälschlicherweise darauf, der Angeklagte habe bereits eine "erstinstanzliche Verurteilung durch das Bezirksgericht Bülach vom 5. Dezember 2001" erfahren, wurde doch genau dieses Urteil vom Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 20. August 2002 (act. 1) aufgehoben.
Die Widersprüche zwischen dem erst- und zweitinstanzlichen Urteil, sowie mit der vorliegenden Verurteilung bezüglich einer Äusserung, bezüglich der im vorliegenden Verfahren eine rechtskräftige Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vorliegt, beweist die menschenrechtswidrige Unbestimmtheit ganz konkret (siehe den Abschnitt "Zu lit c der Anklageschrift vom 28. April 2003" in Ziffer 4.9).
4.5.5
Es ist nicht die Aufgabe der Verteidigung, über die Gründe der Anklage zu spekulieren. Der Angeschuldigte darf "nicht genötigt werden, aufs Geratewohl sich gegen alle Eventualitäten zur Wehr zu setzen" (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Auflage, § 50, Rz 7).
4.5.6
Die Nachtragsanklage (act. 15/8) bietet mangels Erfüllung der Anforderungen an § 162 StPO und EMRK Art. 6 Ziff. 3 die Voraussetzungen für eine wirksame Verteidigung nicht.
Ebenso wenig genügt die Anklageschrift den Anforderungen, welche die bundesgerichtliche Praxis an sie stellt:
So BGE 126 I 21, E 2a ausdrücklich: "Die Anklage hat die dem Angeklagten zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe genügend konkretisiert sind" und hält fest, dass das Anklageprinzip zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte des Angeschuldigten und seinem Anspruch auf rechtliches Gehör dient.
4.5.7
In beiden erstinstanzlichen Verhandlungen (act. 27 S. 1 ff, Prot. S. 8ff und act. 46 S. 1 ff und Prot. S. 44 ff) erhob die Verteidigung vorgängig der Verhandlung über die Sache Einwendungen zur Anklage i.S.v. § 182 StPO, rügte deren Mangelhaftigkeit und verlangte die Rückweisung der Anklageschriften an die Bezirksanwaltschaft zur Verbesserung der Mängel. Leider drang die Verteidigung dannzumal mit diesen Anträgen nicht durch.
4.5.8
Dass eine Rückweisung an die Untersuchungsbehörde zur Verbesserung von Mängeln der Anklageschrift zulässig, ja sogar zwingend ist, entschied das Bundesgericht in 120 IV 348 Erw. 2 ff: Das Bundesgericht wies eine mangelhafte Anklageschrift an die (Bundes-)Anwaltschaft zurück und führte dazu aus, das Anklagezulassungsverfahren solle den Angeklagten vor ungerechtfertigter Anklage und insbesondere vor einer allenfalls unnötigen Prangerwirkung des öffentlichen Gerichtsverfahren schützen. Gleiches muss in casu für den BF gelten. Es wäre die Fürsorgepflicht der Vorinstanz gewesen, die Nachtrags-Anklage – zumindest in dieser Form – nicht zuzulassen und von Amtes wegen, spätestens aber auf den Antrag der Verteidigung hin – zur Verbesserung an die Untersuchungsbehörden zurückzuweisen.
4.5.9
Die Vorinstanz räumt die Unbestimmtheit von Art. 261bis StGB zwar ein (Seite 17ff), hält dem aber entgegen, dem Bestimmtheitsgebot komme in der Rechtsanwendung nur eine geringe Bedeutung zu; dieses richte sich primär an den Gesetzgeber; dem verpönten "chilling effect" könne mit einer zugunsten der Meinungsäusserungsfreiheit zurückhaltende Anwendung Rechnung getragen werden. Was die Vorinstanz hätte tun können, interessiert hier nicht; sie tat es jedenfalls nicht und verurteilte den BF wegen Äusserungen, deren angebliche Strafbarkeit werder für ihn selber, noch für seine Verteidiger und die breite Öffentlichkeit nachvollziebar ist.
Die Vertragsstaaten der EMRK haben dafür zu sorgen, dass eine strafrechtliche Anklage so klar und verständlich ist, dass eine wirksame Verteidigung ermöglicht wird. Auf welcher Stufe und durch welche Instanzen und Institutionen das Bestimmtheitsgebot verletzt und eine wirksame Verteidigung dadurch erschwert oder verunmöglich wird, ist nicht entscheidend. Die Schweiz ist als EMRK-Vertragsstaat als Ganzes verpflichtet, und damit jede Instanz auf jeder Stufe, EMRK 6 zu beachten.
Ein Angeklagter hat gemäss Artikel 6 EMRK das Recht, frühzeitig, spätestens anlässlich der Anklage (Villiger, Handbuch der EMRK 2. Auflage Rz 506) "in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden" (Villiger Rz 504). Dazu gehört ausdrücklich und im Gegensatz zu den Behauptungen der Vorinstanz auch die strafrechtliche Würdigung (Villiger Rz 507).
Die Vorinstanz ist auf diese Rüge im Rückweisungsgesuch unter Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht eingegangendem und dem Kern der Sache ausgewichen (Seite 27 ff), indem sie die Verantwortung für das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot einfach dem Gesetzgeber zugewiesen und erklärt hat, das Gericht dürfe die Anwendung unbestimmter Bundesgesetze nicht verweigern.
Ergebnis: Sowohl die Anklagebehörde wie auch die beiden Vorinstanzen hätten der unbestrittenen Unbestimmtheit von Art. 261bis StGB durch Aufklärung des Angeklagten, warum er sich mit seinen kritischen Äusserungen zum Schächten strafbar gemacht haben, Rechnung tragen können und müssen. Indem dies unterlassen wurde, sind die Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 schwerwiegend verletzt worden.
4.5.10
Die allgemeine Praxis sehr knapp gehaltener Anklageschriften ist zumindest dann nicht EMRK-konform, wenn es um eine Anklage gestützt auf eine unbestimmte Strafnorm geht, die wie StGB Art 261bis in ihrer Unbestimmtheit selbst schon menschenrechtswidrig das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot verletzt (Villiger Rz 546; EGMR-Urteil Amann c. Schweiz, vollständiges Urteil in der Entscheidsammlung des EGMR unter www.echr.coe.int).
4.5.11
Das unerträgliche Übermass an Unbestimmtheit von Art 261bis StGB ist von namhaften Rechtsprofessoren zu Recht kritisiert worden (Stratenwerth: Strafrecht; Trechsel: Kurzkommentar zum StGB; insbesondere auch die ausführliche Behandlung durch Karl Ludwig Kunz in der ZStrR, welche vor Obergericht zu den Akten gegeben wurde) und zeigte sich im Frühjahr 1999 auch in der Parlamentsdebatte über die Aufhebung der Immunität von Nationalrat Keller. Die WELTWOCHE kommentierte wie folgt:
Misstrauen in eigener Sache.
Da haben sie nun die Bescherung, die Damen und Herren Parlamentarier. Ihr Kollege vom rechten Flügel, der Nationalrat und Präsident der Schweizer Demokraten Rudolf Keller, hat sich mit seiner Forderung - 'sämtliche amerikanische und jüdische Waren' seien zu boykottieren - ins Rampenlicht gesetzt... Eine Mehrheit beider Räte wäre zwar der Ansicht, dass Keller sich für seine Aussage verantworten müsste. Doch sie misstraut dem Gesetz, das sie selbst geschaffen und mit moralischem Druck durch die Volksabstimmung gebracht hat: der Strafnorm gegen Rassismus. Die Situation ist paradox: Im Ständerat wandte sich die SP-Politikerin Christiane Brunner gegen die Aufhebung von Kellers Immunität. Sie glaubt nicht, dass die gesetzliche Grundlage für einen Schuldspruch ausreicht. Diese Einschätzung teilt SVP-Ständeherr Maximilian Reimann, der gerade deshalb für die Aufhebung der Immunität eintrat. Im Nationalrat das umgekehrte Bild: Die Ratslinke und manche Bürgerlichen meinen, dass es garantiert zu einer Verurteilung käme, und stimmten deshalb für eine Aufhebung des parlamentarischen Schutzes. Eine rechtsbürgerliche Minderheit befürchtete hingegen eine Verurteilung und stimmte nein. ... Wie viele Keller und Kessler braucht das Parlament noch, bis es endlich die Mängel des Gesetzes behebt?
Und der Tages-Anzeiger schrieb in seiner Ausgabe vom 1. März 1999:
Wird das Rassismus-Verbot abgeschwächt?
Nicht harmlos: Die Anti-Rassismus-Strafnorm war noch keine zweieinhalb Jahre in Kraft, als der Thurgauer Carrossier und FPS-Nationalrat Wilfried Gusset schon eine Abänderung verlangte: Sie müsse präzisiert, eingeengt, volksnaher formuliert werden, heisst es im Motionstext, der auch von Christoph Blocher (SVP), Ernst Mühlemann (FDP) und 50 weiteren Ratsmitgliedern unterschrieben wurde. Vor allem müsse die Bestrafung der Rassen- und Religionsdiskriminierung von "klar definierter böswilliger Absicht" abhängig gemacht werden....
4.5.12
Die amtliche Verteidigerin rügte sowohl vor erster wie auch vor zweiter Instanz die Hervorhebungen durch Unterstreichungen in der Anklageschrift, womit der falsche Eindruck erweckt wurde, der BF habe diese Stellen besonders betont. In Tat und Wahrheit hat die Bezirksanwaltschaft diese Hervorhebungen zugefügt, ohne dies klar zu stellen und ohne zu erklären, wozu diese Hervorhebungen dienen sollen. Bis heute ist unklar, welche Bedeutung diesen Unterstreichungen zukommt. Sind nach Auffassung der Anklagebehörde nur die unterstrichenen Stellen rechtswidrig? Welche Bedeutung haben dann die nicht unterstrichenen? Das ist jedenfalls nicht offensichtlich. Um aufzuzeigen, in welchen Kontext die unterstrichenen Stellen eingebettet waren, sind demgegenüber die nicht unterstrichenen Stellen zu kurz.
Die Vorinstanz rechtfertigt diese Hervorhebungen mit Erklärungen (Seite 15, lit f), welche weder der Anklageschrift, noch dem erstinstanzlichen Urteil entnommen werden konnten (obwohl die amtliche Verteidigerin diese Rüge schon in ihrem Plädoyer vor erster Instanz vorbrachte).
Zudem ist die vom Obergericht nun nachgeschobene Erklärung, mit den Unterstreichungen habe die Anklagebehörde Klarheit geschaffen, "welche konkreten Textstellen die Anklagebehörde als rassendiskriminierend erachtet", absolut unverständlich. So sind in der Anklageschrift vom 8. August 2000 beispielsweise folgende Textstellen unterstrichen:
Unter Ziffer II. die Wörter "Nazis" und "Schächten".
Unter Ziffer III. die Textstellen "Authentische Zitate aus ihrem 'Talmud" und "Hitlers 'Mein Kampf'"
Unter Ziffer VII. "jeder Sekte bei uns Verrichtungen einräumen würden"
Sind das alles verbotene Wörter?!
Kein normaler Mensch und insbesondere auch nicht die als Verteidiger wirkenden patentierten Rechtsanwälte, einschliesslich der dem Angeklagten vom Staat beigestellten amtlichen Verteidigerin, ebensowenig der Angeklagte selber, kann mit dem Vorhalt, bei diesen unterstrichenden Textstellen handle es sich um strafbare rassendiskriminierende Äusserungen irgend etwas anfangen. Eine gezielte, menschenrechtskonforme wirksame Verteidigung wurde deshalb durch Art und Form der Anklage vereitelt.
4.5.13
Die Vorinstanz weist (Seite 12ff) diese Rüge mit der Begründung zurück, gemäss StPO seien in die Anklageschrift keine rechtlichen Erörterungen aufzunehmen. Indessen gehen Verfassung und EMRK den kantonalen Prozessvorschriften vor. Das Verbot der Unbestimmtheit strafrechtlicher Vorschriften ist ein Grundsatz der Verfassung und der EMRK und alle Instanzen haben dies zu beachten. Die Anklage hätte deshalb der EMRK-widrigen Unbestimmtheit des Rassismus-Tatbestandes Rechnung tragen und genau definieren müssen, weshalb sich der Angeklagte mit den ihm vorgehaltenen Äusserungen strafbar gemacht haben soll, umso mehr als ihm Äusserungen vorgehalten werden, von denen weder er selber, noch seine Verteidiger noch überhaupt ein normaler Mensch versteht, was daran rassendiskriminierend sein soll.
Weil sowohl die gesetzliche Tatbestandsumschreibung wie auch die Anklageschrift vage sind, wurde eine wirksame Verteidigung vor erster Instanz verunmöglicht. Dadurch wurde EMRK 6.3 verletzt. Gemäss Praxis des EGMR gelten die Verteidigungsrechte im gesamten Verfahren und es genügt nicht, wenn ein Angeklagter erst aufgrund des erstinstanzlichen Urteils weiss, was ihm weshalb vorgeworfen wird.
Die Vorinstanz hat sich mit diesen im Rückweisungsgesuch ausführlich begründeten Rügen nicht befasst und damit das rechtliche Gehör verletzt.
4.5.14
Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, zweite Auflage, §4 N 15:
Am wenigsten erträglich ist ein Übermass an Unbestimmtheit bei der Umschreibung des mit Strafe bedrohten Verhaltens.
Dieser "unerträgliche" Fall wurde mit dem Rassismus-Strafartikel (StGB Artikel 261bis ) geschaffen, wie die Unberechenbarkeit seiner Anwendung seit dem Inkrafttreten immer wieder gezeigt hat. Entgegen den Beruhigungen des Bundesrates im Abstimmungskampf greift die Anwendung dieser Strafnorm nun direkt in den normalen Alltag, in die normale politische Diskussion ein. Kein Rechtsanwalt kann einigermassen zuverlässig voraussagen, was bei Themen wie Überfremdung, Nazi-Gold oder Schächten noch gesagt werden darf und was nicht. Insbesondere öffentliche Äusserungen in Bezug auf jüdisches Verhalten, sind in unberechenbarer Weise nicht mehr vor Strafverfolgung sicher. Die vorliegende Verurteilung eines Tierschützers, der sich ausschliesslich nur im Zusammenhang mit dem grausamen Schächten über Juden geäussert hat, zeigt dies deutlich.
Nach Stratenwerth ermöglichen unbestimmte Strafnormen eine diskriminierende Anwendung. Wie recht er hat, zeigt sich in der krass diskriminierenden Anwendung von Artikel 261bis (siehe Ziffer 4.7). Sowohl die Verletzung des Bestimmtheitsgebotes wie auch die diskriminierende Anwendung, welche eine diskriminierende Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit darstellt, verletzen die Europäische Menschenrechtskonvention (zum Bestimmtheitsgebot siehe Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar 2. Auflage, Seite 329).
4.5.15
Es ist menschenrechtswidrig (EMRK 6) vom BF zu verlangen, dass er der Unbestimmtheit des gesetzlichen Tatbestandes und der dadurch entstandenen Rechtsunsicherheit dadurch Rechnung trage, dass er aus blosser Vorsicht auf die Wahrnehmung der Meinungsäusserungsfreiheit substanziell verzichte (verpönter chilling effect), geht es hier doch um ein Anliegen von öffentlichem Interesse. Tierschutz hat in der Schweiz Verfassungsrang und ist seit Jahren Gegenstand einer intensiven öffentlichen Auseinandersetzung, welche die im Gang befindliche gesellschaftliche Entwicklung in der Einstellung zum Tier als Mitgeschöpf begleitet. Es ist mit der Meinungsäusserungsfreiheit unvereinbar - wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) immer wieder betont hat -, die für eine freiheitliche Gesellschaft fundamentale Auseinandersetzung über kontroverse Ansichten durch Beschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit zu unterdrücken. Die Meinungsäusserungsfreiheit ist ein hohes Gut; sie muss ohne Angst vor Strafe wahrgenommen werden können. Staatliche Eingriffe jeder Art verlangen eine zwingende Notwendigkeit und eine Beschränkung auf das absolut Notwendige. Die Verurteilung des BF wegen angeblicher Rassendiskriminierung trägt dem in bundesrechtswidriger und willkürlicher Weise nicht Rechnung.
4.5.16
Der Einwand, das Bestimmtheitsgebot richte sich nicht an den Richter, sondern an den Gesetzgeber, übersieht, dass die Schweiz als Vertragsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) die verbindliche Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte auf allen staatlichen Ebenen und durch alle staatlichen Instanzen hat. In diesem Verfahren können nur die Richter diese Verpflichtung wahrnehmen. Sie sind dazu befugt und verpflichtet, weil die EMRK übergeordnetes Recht darstellt und darum im Wege stehende verfahrensrechtliche Vorschriften aufhebt. Einer vom Gesetzgeber verschuldeten, EMRK-widrigen Unbestimmtheit eines Straftatbestandes hat der Richter durch enge Auslegung Rechnung zu tragen. Vorliegend erfolgte in bundes- und menschenrechtswidriger Weise willkürlich das Gegenteilt: Dem BF wurden zwar scharfe, aber sachlich begründete Kritik an Tierquälereien in einer Weise als rassendiskriminierend vorgehalten, wie dies kein normaler Mensch und auch die meisten Rechtsanwälte nicht verstehen können - unter völliger Missachtung der in der Lehre geltenden Definitionen der entscheidenden Tatbestands-Begriffe (siehe Ziffer 4.2 und 4.3).
4.5.17
Die Nichtberücksichtigung der Unbestimmtheit der der Verurteilung des BF zugrundeliegenden Tatbestandsumschreibung erfolgte in diskriminierender Weise (EMRK 14 iVm EMRK 6), denn in anderen Fällen führte eine solche Unbestimmtheit gesetzlicher Vorschriften zu Freisprüchen:
a)
Artikel 3 Abs 2 TSchG lautet: "Die für ein Tier notwendige Bewegungsfreiheit darf nicht dauernd oder unnötig eingeschränkt werden, wenn damit für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind." In der Fachliteratur (Pferdesport) wird die Anbindehaltung von Pferden als tierquälerisch beurteilt. Gegenteilige Expertenmeinungen sind nicht bekannt. In den Richtlinien zur Pferdehaltung des Bundesamtes für Veterinärwesen wird Art 3 TSchG dahingehend augelegt, dass Pferde nicht in Anbindehaltung gehalten werden dürfen. Max Anrig, Sargans, hatte unbestritten gegen das Anbindehalteverbot für Pferde verstossen. Auf Anzeige des VgT hin wurde er von der St Galler Staatsanwaltschaft mit Entscheid vom 25. April 2003 freigesprochen, mit der Begründung, Art 3 TSchG sei keine genügend klare gesetzliche Grundlage für eine Verurteilung, obwohl jedenfalls nicht weniger klar als das unbestimmte Rassendiskriminierungsverbot.
b)
Artikel 18 der eidgenössischen Tierschutzverordnung lautete damals, als es zum folgenden Verfahren kam: "Rindvieh, das angebunden gehalten wird, muss sich zeitweise ausserhalb der Standplätze bewegen können." Der Solothurner Tierschutzinspektor Kummli dispensierte einzelne Tierhalter rechtswidrig von der Einhaltung dieser Tierschutzvorschrift und unterstützte damit die lebenslängliche Anbindehaltung von Kühen in dunklen Ställen. Mit Urteil vom 2. Juni 2000 sprach das Solothurner Obergericht Kummli von der Mittäterschaft und Amtspflichtverletzung frei mit der Begründung, die gesetzlichen Vorschriften seien nicht genügend bestimmt (www.vgt.ch/vn/0501/kummli.htm).
4.6 Der Angeklagte war vor beiden Vorinstanzen materiell nicht verteidigt
4.6.1
Bezüglich der inkriminierten angeblich rassistischen Äusserungen, die allesamt im Zusammenhang mit dem von fundamentalistischen jüdischen und moslemischen Minderheiten praktizierten betäubungslosen Schächten stehen, war der Angeklagte/Beschwerdeführer (BF; Erwin Kessler) in beiden Vorinstanzen nicht materiell verteidigt, obwohl ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt.
4.6.2
Der Vorsitzende der ersten Instanz forderte die Verteidigung auf, auch zur Anklage der Rassendiskriminierung zu plädieren. An der Fortsetzung der Verhandlung am 3. September 2003 erläuterte die amtliche Verteidigerin nochmals ausführlich, warum sie sich nicht imstande sehe, den Angeklagten bezüglich der Anklage wegen Rassendiskriminierung im Zusammenhang mit der Diskussion um das Schächten materiell zu verteidigen (Plädoyer-Notizen Seite 1 ff).
4.6.3
Der erbetene Verteidiger hatte der ersten Instanz mit Schreiben vom 5. September 2001 mitgeteilt, dass er den Angeklagten mit Blick auf die grosse Rechtsunsicherheit (Verletzung des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebotes) bei der Auslegung der Rassendiskriminierungs-Strafnorm nicht materiell verteidigen können, ohne selber ein Strafverfahren wegen Rassendiskriminierung zu riskieren. Die amtliche Verteidigerin äusserte sich in gleichem Sinne und legte an der Verhandlung vom 28. Mai 2003 dar, dass die Anklageschrift den Anforderungen von EMRK 6 nicht genüge, indem weder der Angeklagte noch die beiden Verteidiger daraus entnehmen konnten, worin die Tatbestandsmässigkeit der inkriminierten Äusserungen zum Schächten liege, und dass es Pflicht der Anklage sei, dem Angeklagten "in allen Einzelheiten" mitzuteilen, was man ihm vorwerfe und weshalb und dass es mit den menschenrechtlich garantierten Verteidigungsrechten nicht vereinbar sei, wenn der Angeklagte und seine Verteidiger dies erst aus der erstinstanzlichen Urteilsbegründung erfahren, und dass es auch nicht zumutbar sei, dass die Verteidigung sich in Mutmassungen über die Gründe der Anklage ergehe - zumal die Antirassismusstrafnorm derart unbestimmt und die Praxis dazu derart unberechenbar sei, dass die Verteidiger damit selber ein Strafverfahren riskieren würden. Aus diesen Gründen beantragte die amtliche Verteidigerin die Rückweisung der Anklage an die Untersuchungsbehörde.
4.6.4
Bereits im Plädoyer vor erster Instanz vom 28. Mai 2003 wie auch am 3. September 2003 (act. 27 S. 1 ff und act. 46) wies auch die amtliche Verteidigung darauf hin, dass sich jeder Anwalt, der zur Verteidigung seines Klienten gestützt auf diese schwammige Anklage ausholt, sich selber dem Risiko eines Strafverfahrens i.S. von Art. 261bis StGB aussetzt. Niemand, auch nicht ein Verteidiger, sei verpflichtet, sich in Ausübung seiner Berufspflichten wissentlich dem Risiko einer eigenen Strafverfolgung auszusetzen.
4.6.5
Die Behauptung des Obergerichtes (Seite 18), die Verteidigung hätte ja entsprechende Äusserungen schriftlich einreichen können, um die Öffentlichkeit an der mündlichen Verhandlung zu umgehen, widerspricht der extensiven Definition des Öffentlichkeitskriteriums in BGE 6S.318/2004). Danach sind Eingaben an ein Gericht eindeutig öffentliche Äusserungen im Sinne von Art. 261bis StGB. Die Gruppe der Richter, mit denen die Verteidigung weder familiär noch freundschaftlich verbunden ist, ist gemäss dem zitierten BGE bereits ein öffentlicher Personenkreis. Darüberhinaus hat es die Verteidigung nicht in der Hand, wie das Gericht diese Eingabe im öffentlichen Urteil zitiert.
4.6.6
Fehl geht auch der Einwand des Obergerichtes (Seite 18), die Verteidigung hätte ja den teilweisen Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen können. Das Obergericht übersieht, dass dies das Öffentlichkeitsgebot verletzen würde, denn es liegen keine gesetzlichen Gründe vor, die Öffentlichkeit auszuschliessen; die Öffentlichkeit darf nur zum Schutz des Angeklagten oder Geschädigter ausgeschlossen werden.
4.6.7
Laut Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Auflage § 60, RZ 1037, ist die Berufungsverhandlung zu vertagen, wenn in einem Fall notwendiger Verteidigung der Verteidiger nicht erscheint oder sich zur Begründung der Berufung ausserstande erklärt. Das trifft hier zu: Sowohl der Wahlverteidiger als auch die Pflichtverteidigerin haben vor erster Instanz wie auch an der Berufungsverhandlung erklärt, dass und warum eine menschenrechtskonforme, wirksame materielle Verteidigung bezüglich der Anschuldigung rassistischer Veröffentlichungen zum Schächten, nicht möglich ist (siehe die Plädoyers der Verteidigung, insbesondere das Plädoyer der amtlichen Verteidigerin an der Berufungsverhandlung).
4.6.8
Die Vorinstanz räumt ein (Seite 32), dass der BF bezüglich Rassendiskriminierung nur "rudimentär" materiell verteidigt gewesen sei, wobei die wenigen, pauschalen materiellen Bemerkungen eigentlich nicht einmal als "rudimentäre" Verteidigung qualifiziert werden können. Auf Seite 32 geht die Vorinstanz noch weiter und stellt fest:
Von einer ernsthaften, einigermassen sorgfältigen Wahrnehmung des Verteidigungsmandates kann insoweit auch unter Berücksichtigung der grosssen Gestaltungsfreiheit, die einem Strafverteidiger nach dem Gesagten zuzubilligen ist, kaum die Rede sein.
Der BF macht indessen nicht die amtliche Verteidigerin, sondern das Gericht dafür verantwortlich, dass - aus den oben dargelegten Gründen - eine verantwortbare materielle Verteidigung nicht möglich war.
Der BF blieb in diesem Anklagepunkt, in dem er dann schuldig gesprochen und zu Gefängnis unbedingt verurteilt wurde, jedenfalls ohne wirksame Verteidigung (Verletzung von EMRK 6), was die Vorinstanz auch explizit festgestellt hat (Seite 35, Ziff 6. i. ll). Von einem ordnungsgemässen, menschenrechtskonformen Verfahren kann deshalb nicht die Rede sein.
4.6.9
Indem der BF und seine Verteidiger erst aus der erstinstanzlichen Urteilsbegründung erfuhren, warum die inkriminierte Kritik an den Schächtjuden das Rassendiskriminierungsverbot verletzen soll, wurde der BF zudem der ersten Instanz beraubt (siehe Ziffer 1).
4.7.1
Die unter Ziffer 4.5 dargelegte menschenrechtswidrige Unbestimmtheit von StGB 261bis wird zu politischen Zwecken missbraucht. Es kommt weniger darauf an, WAS jemand sagt, sondern WER etwas sagt. Der oben in Ziffer 4.1.16 parodierte Fall Christoph Blocher zeigt das deutlich.
4.7.2
Ein weiterer Fall von Diskriminierung stellt die vorliegende Verurteilung des BF wegen einer Veröffentlichung dar, die zuvor rechtskräftig als nicht tatbestandsmässig beurteilt wurde (siehe nachfolgend Ziffer 4.9, Zu Ziffer VII der Anklageschrift vom 8. August 2000, betr Manfred Kyber).
4.7.3
In seinem Buch "Die Antwort" (Aristoteles-Verlag) äussert sich der Jude Bruno Cohn wie folgt aufhetzerisch und herabmindernd gegen das Christentum und gegen das Schweizervolk:
... das Christentum hat es sich ja recht einfach gemacht. Es ignoriert die bösen Dinge dieser Welt und versteht sich fernab von allem Bösen als der Lichterglanz des Guten. (Seite 369)
Dieser in der unrühmlichen schweizerischen Rechtsgeschichte allgemein als 'Schächtartikel' ... bekannt gewordene Paragraph des Grundgesetzes war ein recht plumper Angriff auf die Juden... ( Seite 376)
Und Seite 377 schreibt Cohn auf die Schweiz bezogen weiter:
... ein geistig eher rückschrittliches Volk....
Und schliesslich behauptet er auch noch (Seite 376), Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg hätte es eher verdient, Schweizer Nationalheld zu sein, als Wilhelm Tell.
Die Bezirksanwaltschaft Zürich hat diese rassistische Beleidigung der Christen und eines ganzen Volkes als "wissenschaftliches, differenziert argumentierendes Buch" beurteilt und die Anzeige des BF wegen Rassismus abgewiesen (Aktenzeichen B./Unt.Nr. B-13/1995/07787). Die Äusserungen müssten im Zusammenhang gesehen werden. Deshalb sei der Tatbestand des Rassismus nicht erfüllt. Dies hätte der BF auch selbser merken müssen. Die Anzeige sei deshalb leichtfertig erfolgt, weshalb ihm als Anzeigerstatter die Verfahrenskosten von Fr 715.10 überbunden würden.
Die herabmindernden Äusserungen Cohns über das Christentum und das Schweizervolk sollen also "wissenschaftlich" und "differenziert" und deshalb nicht rassistisch sein. Fadenscheiniger geht es ja wohl nicht mehr! In der vorinstanzlichen Verurteiltung des BF wurde der tierschützerische Zusammenhang nicht in ähnlicher Weise berücksichtigt, und es wird in der Anklageschrift völlig übergangen, dass der BF in den inkriminierten Veröffentlichungen insgesamt differenziert argumentiert und sachliche Gründe vorbringt. Die Veröffentlichungen des BF sind - insbesondere auch zum Schächten - mindestens so differenziert und "wissenschaftlich" wie das Buch von Cohn.
4.7.4
Wenn der BF christlichen Klöstern, welche Tier-KZs betreiben, vorwirft, sie seien nicht besser als damals die Nazis, dann ist bisher niemand auf die Idee gekommen, das sei rassendiskriminierend. Dem damaligen Abt des Klosters Einsiedeln hat der BF die damalige tierquälerische Ausbeutung der Nutztiere im Kloster Fahr (der neue, fortschrittlicher Abt von Einsiedeln hat in einer ersten seiner Amtshandlungen, diese tierquälerischen Missstände beseitigt und den Betriebsleiter entlassen) äusserst scharf kritisiert, mit folgenden Worten (Beilage 3):
Angesichts der eiskalten Haltung christlicher Würdenträger gegenüber der Tierausbeutung kann ich nur feststellen: Wenn es Ihren Gott ,den Allmächtigen, wirklich gibt, dann ist er entweder kriminell oder nicht so allmächtig, wie Sie in der Kirche predigen.
Der BF hat dies bewusst so formuliert, um die diskriminierende Anwendung der Rassismusstrafnorm zu beweisen, denn es war im vornherein klar, dass deswegen keine Anklage erhoben würde, weil hier nicht Juden, sondern "nur" Christen mit Nazis verglichen werden. Der BF hat am 25. Februar 1997 eine Kopie dieser Veröffentlichung im Sinne einer Selbstanzeige der Bezirksanwaltschaft Bülach zugestellt (Beilage 3), welche schon damals und bis heute fleissig Anklagen gegen ihn erhebt, wenn er Schächtjuden kritisiert. Auf diese analoge Kritik an christlichen Tierquälern hat die Bezirksanwaltschaft Bülach nicht reagiert - q.e.d.
Die vorinstanzliche Verurteilung stellt deshalb eine diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit dar (EMRK 14 iVm 10).
4.7.5
Die diskriminierende Anwendung von StGB 261bis ist durch weitere Fälle belegt (Ziffer 4.7.6 bis 4.7.9), die bereits vor erster Instanz geltend gemacht worden sind (Plädoyer des BF zur erstinstanzlichen Verhandlung vom 7. November 2001, Seite 33ff); weder die erste noch die zweite Instanz ist darauf auch nur mit einem Wort eingegangen (Verletzung des rechtlichen Gehörs).
4.7.6
Am 16. März 1998 hat der BF der Bezirksanwaltschaft Zürich folgende Strafanzeige eingereicht:
Tuttwil, den 16. März 1998
An die
Bezirksanwaltschaft Zürich
Postfach
8026 ZürichHiermit erhebe ich
Strafanzeige wegen Verbreitung rassistischer Bücher
gegen die Verantwortlichen der
1. Zentralbibliothek Zürich
2. Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich
3. Universitätsbibliothek Basel
Antrag:
Der babylonische Talmud sei in allen schweizerischen Bibliotheken und Buchhandlungen zu beschlagnahmen und die Verantwortlichen seien angemessen zu bestrafen, mindestens mit 45 Tagen Gefängnis.
Begründung:
Die Angezeigten 1 bis 3 sowie vermutlich verschiedene Buchhandlungen und weitere Bibliotheken stellen den "Babylonischen Talmud", ein zwölfbändiges, hochgradig rassistisches Buch, der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Darin sind die folgenden rassistischen Äusserungen gegenüber nichtjüdischen Volksgruppen bzw Völker und Religionen zu finden, welche an Arroganz und Brutalität sogar die Nazi-Propaganda gegen Nicht-Arier in den Schatten stellt:
"Wer die Scharen der Nichtjuden sieht, spreche: Beschämt ist Eure Mutter, zu Schande, die euch geboren hat."
"Wer die Gräber der Nichtjuden sieht, spreche: Beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat."
"Weshalb sind die Nichtjuden schmutzig? Weil sie Ekel und Kriechtiere essen."
"Wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Israelitin beiwohnt, so ist das Kind ein Hurenkind."
"Jener Mann [gemeint ist Jesus] ist ein Hurenkind von einem verheirateten und hurenden Weibe geboren."
"Unter Hure sind nur die Proselytin (die Nichtjüdin), die freigelassene Sklavin und die in Unzucht Beschlafene zu verstehen."
"Ihr aber [gemeint sind die Juden] seid meine Schafe..., Menschen seid ihr. Dh ihr heisst Menschen, die [weltlichen] Völker [aber] nicht Menschen."
"Der Samen der Nichtjuden ist ein Viehsamen."
"Gleich wie der Kalk keinen Bestand hat, sondern verbrannt wird, so haben auch die weltlichen (nichtjüdischen) Völker keinen Bestand (im Weltgericht), sondern werden verbrannt."
"Wenn der Ochse eines Israeliten den Ochsen eines Nichtjuden niedergestossen hat, so ist er ersatzfrei."
"Die Beraubung eines Bruders (Israeliten) ist nicht erlaubt, die Beraubung eines Nichtjuden ist erlaubt..."
"Die Güter der Nichtjuden gleichen der Wüste, sind wie ein herrenloses Gut und jeder, der zuerst von ihnen Besitz nimmt, erwirbt sie."
"Es wird bezüglich des Raubes gelehrt: Diebstahl, Raub und Raub einer schönen Frau und desgleichen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten, und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Das Blutvergiessen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt."
"Der Beischlaf der Fremden (Nichtjuden) ist wie Beischlaf der Viecher."
Sollten Sie diese Stellen in den einzelnen Ausgaben nicht finden, bin ich Ihnen gerne behilflich.
Mit freundlichen Grüssen
Erwin Kessler
Am 31. März teilte die Bezirksanwaltschaft (Büro3/Varia Nr 98/165), unterzeichnet von BA lic iur M-E Geiger, dem BF mit, dass auf die Anzeige nicht eingetreten werde: "Ich beabsichtige nicht, die Richtigkeit Ihrer Feststellungen nachzuprüfen bzw mich auf eine religionswissenschaftliche Diskussion einzulassen... Ich muss Sie bitten, unsere Zeit nicht mit derart unsinnigen Anzeigen zu verschwenden."
Wenn Juden gegen Nichtjuden rassistisches Gedankengut verbreiten wie in den obigen Zitaten aus dem Talmud, das in seiner abgrundtiefen Menschenverachtung dem nationalsozialistischen Arierwahn nicht nachsteht, dann ist das gemäss der von der Schweizer Justiz praktizierten diskriminierenden Auslegung des Diskriminierungsverbotes offenbar schon im vornherein rechtlich nicht relevant. Dem Anzeigeerstatter, der es wagte, jüdische Kreise des Rassismus zu bezichtigen, werden Verfahrenskosten angedroht wegen "leichtfertiger oder gar böswilliger Anzeigeerstattung", ohne auf die Begründung der Anzeige überhaupt einzugehen, weil offenbar im vornherein jeder, der Juden kritisiert, ein Rassist ist, und Juden, egal was sie tun und schreiben, niemals Rassisten sind (und auch keine Unmenschen, wenn sie Tiere grausam zu Tode foltern). Eine extremere Voreingenommenheit und Diskriminierung ist wohl kaum mehr denkbar! Wenn die nationalen Gerichte sich derart der Politik verpflichtet fühlen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Recht zu sprechen, wird sich einmal mehr der EGMR mit dieser Verletzung der Menschenrechtskonvention (EMRK 14 iVm 10) befassen müsssen.
Es geht hier nicht um "Gleichbehandlung im Unrecht", sondern um die unter Ziffer 4.5 dargelegte menschenrechtswidrige Unbestimmtheit und um die diskriminierende Anwendung des Rassismus-Artikels, welcher - wie die angeführten Beispiele beweisen - bei ähnlichem Sachverhalt völlig gegenteilig und damit willkürlich angewendet werden kann und angewendet wird. Die Schweiz als Vertragsstaat der EMRK ist verpflichtet, Grundrechtseingriffe nicht diskriminierend zu handhaben, und die Rechtsunterworfenen müssen sich - gerade bei einem derart unbestimmten Strafartikel - auf die Rechtsprechung in anderen Fällen verlassen dürfen.
4.7.7
Ein Rassismus-Verfahren gegen Bundesrat Delamuraz ist eingestellt worden mit der Begründung, seine Äusserungen qualifizierten das Verhalten jüdischer Kreise innerhalb eines bestimmten Kontextes, nicht aber diese selbst (Beilage 2). Genau gleich liegt der Fall hinsichtlich der inkriminierten Kritik des BF am Schächten und an den Schächtjuden: Er kritisiert nicht ihre Religionszugehörigkeit, sondern ihr tierquälerisches Verhalten. Dieser Unterschied wurde vorliegend von beiden Vorinstanzen diskriminierend nicht gewürdigt, obwohl der BF in seinem Plädoyer zur Hauptverhandlung vor Bezirksgericht am 7. November 2001, Seite 30, zu Recht darauf hingewiesen hat, er habe die Schächtjuden nur wegen ihrem tierquälerischen Verhalten, nicht weil sie Juden sind, kritisiert. Damit ist auch in diesem urteilsentscheidenden Punkt das rechtliche Gehör verletzt und die Meinungsäusserungsfreiheit diskriminierend verletzt worden (nicht EMRK-konforme, willkürliche Auslegung der Rassismus-Strafnorm StGB 261bis).
4.7.8
Im Abstimmungskampf um den Maulkorbartikel StGB 261bis hat Sigmund Feigel, Ehrenpräsident der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, über Radio DRS die rund 45 Prozent der Schweizer Stimmbürger, welche dann das untaugliche Antirassismusgesetz abgelehnt haben, als "das grösste politische Lumpengesindel" bezeichnet. Das ist legal. Nicht legal ist hingegen Kritik am schächtenden Lumpengesindel, weil dieses diskriminierende Diskriminierungsverbot nicht nach rechtstaatlichen Grundsätzen sondern nach politischer Opportunität angewendet wird und es immer darauf ankommt, WER was sagt.
4.7.9
Ein jüdischer Kürschner hat in der WELTWOCHE vom 14. März 1996 die Pelzgegner, also insbesondere auch die Mitglieder der vom BF präsidierten Schweizerischen Glaubensgemeinschaft militanter Tierschützer HEIFRA, als Nazis beschimpft, weil sie zum Boykott der grausamen Pelzmode aufrufen. Der Vereinsname HEIFRA ist ein Kürzel, das zu Ehren des Heiligen Franz von Assisi gewählt worden ist. Diese Glaubensgemeinschaft wurde am 26. September 1994, einen Tag nach der knappen Annahme des Antirassismus-Gesetzes durch das Volk, gegründet, weil normale Schweizer nicht in den Genuss dieses Diskriminierungsverbotes kommen. Gemäss Statuten vertritt die HEIFRA alle Menschen mit folgendem Glaubensbekenntnis:
1. Wir Tierschützer glauben daran, dass unsere Haus- und Nutztiere Schmerzen und Leiden ähnlich erleben wie wir selbst.
2. Wir Tierschützer sind erfüllt und beseelt vom religiösen Wunsch, die leidenden Tiere von ihrem Elend zu erlösen.
3. Die Angehörigen unserer Glaubensgemeinschaft unterscheiden sich von anderen westlichen Religionen durch ihr Mitleid mit den Tieren und durch ihre Entschlossenheit, die Tiere aus ihrem Elend in Intensivhaltungen und Versuchslabors zu befreien.
Der jüdische Kürschner heisst Hans Mayer. Er betreibt sein tierquälerisches Handwerk in Bubendorf/BL. Im Namen der HEIFRA reichte der BF eine Rassismus-Strafanzeige ein. Das Verfahren wurde eingestellt mit der Begründung, es liege keine Rassendiskriminierung vor, obwohl er die Mitglieder der HEIFRA wegen deren Glaubensüberzeugung mit Naziverbrechern verglichen hat. (Beschluss der Ueberweisungsbehörde des Kantons Basel-Landschaft vom 8.8.1996 in Sachen Hans Mayer, Kürschnermeister, betr Rassendiskriminierung, Aktenzeichen, Ueb Prot Nr 1000/96).
Für den genau umgekehrten Fall wurde der BF von der Vorinstanz zu Gefängnis unbedingt verurteilt - obwohl der BF gute und ehrenwerte Gründe für seine Kritik am Schächten hat, während die rassistischen Äusserungen dieses jüdischen Kürschners nur egoistischen wirtschaftlichen Interessen dienen. Für die gleiche Äusserung, die Juden erlaubt ist, kommen Nichtjuden ins Gefängnis. Es wird nicht beurteilt, WAS gesagt wird, sondern WER etwas sagt. Diese Einseitigkeit im Vollzug von StGB 261bis verletzt das verfassungsmässige Gleichheitsgebot und das menschenrechtliche Diskriminierungsverbot (EMRK 14 iVm 10). Der den Stimmbürgern als "Rassendiskriminierungsverbot" aufgeschwatzte Artikel 261bis StGB führt selber zur gegenwärtig schlimmsten Diskriminierung in der Schweiz.
4.7.10
Indem die Vorinstanz mit keinem Wort auf diese Diskriminierung gemäss obigen Ziffern 4.7.6 bis 4.7.9 - die schon im Plädoyer zur erstinstanzlichen Verhandlung vom 7. November 2001, Seite 33ff, geltend gemacht wurden - einging, wurde das rechtliche Gehör und die Begründungspflicht verletzt (Art 6 EMRK).
4.7.11
Eine weitere diskriminierende Anwendung der Rassismusstrafnorm ist unter Ziffer 4.9, Zu Ziffer III der Anklageschrift vom 8. August 2000, lit b (Tages-Anzeiger) dargelegt.
4.7.12
Ein weiterer Fall diskriminierender Anwendung von StGB
261bis:
Am 7. März 2000 reichte der BF der Bezirksanwaltschaft Bülach eine Anzeige
folgenden Inhalts ein (Beilage 4):
Im sog Schächtprozess haben Sie am 6.3.1997 Anklage gegen mich wegen Rassismus erhoben (B/Unt Nr Büro 5/1995/489). In Ihrer Anklage haben Sie mir Sätze wie zB "Das Antirassismusgesetz ist ein Maulkorbgesetz" als antisemitisch vorgeworfen. Ich gehe davon aus, dass Sie - da laut Bundesverfassung vor dem Gesetze alle gleich sind - auch in anderen Fällen gegen alles, was gewisse Juden nicht gerne hören als strafbar im Sinne der Rassismus-Strafnorm beurteilen.
Da die Auslegung der Rassismus-Strafnorm im Vollzug derart unkalkulierbar und nicht nachvollziehbar ist, dass es völlig unmöglich ist, vorauszusehen, was nun strafbar ist und was nicht, erhebe ich bezüglich der folgenden Sachverhalte nicht formell Strafanzeige, sondern bringe ihnen diese zur Kenntnis, damit Sie - da es um Offizilaldelikte geht - von Amtes wegen die nötigen Schritte einleiten:
1. Rätoromanisches Wörterbuch
Im rätoromanischen Wörterbuch VOCABULARI ROMONTSCH von Ramun Vieli und Alexi Decurtins, 1980 in zweiter Auflager erschienen im Verlag Ligia Romontscha, Chur, werden dem Wort "Jude" zwei Bedeutungen zugeschrieben: Israelit und Wucherer. Für beides wird das rätoromanische Wort "gediu" angegeben.
2. Sonntags Zeitung vom 5.3.00:
Siehe den beiliegenden Artikel aus der Sonntagszeitung (kopiert aus dem Internet), in welchem gewissen jüdischen Kreisen "Gaunerei" vorgeworfen wird, sie würden den Holocaust dazu missbrauchen, um Geld zu machen. Dabei ist zu Beachten, dass die Gericht im sog Schächtprozess gegen mich ausdrücklich festgehalten haben, auch Kritik, die nicht gegen die Juden insgesamt, sondern nur gegen gewisse Juden, erfülle die Rassismus-Strafnorm, da ALLE Juden geschützt seien.
3. Antisemitismus in Werken von Goethe
Gemäss bisheriger Praxis beim Vollzug der Rassismus-Strafnorm müssen die Werke Goethes, denen die folgenden Zitate entnommen sind, unverzüglich beschlagnahmt und gegen die Buchhändler und Bibliothekare Strafverfahren eingeleitet werden:
"Du kennst das Volk, das man die Juden nennt.... sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben... Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr. Er weiss mit leichter Müh' und ohne viel zu wagen, durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen... Auch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen, und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt... Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen; der kommt nicht los, der sich nur einmal eingelassen..." (Goethe, Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilen).
"Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt...; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker" (Johann Wolfgang Goethe - Wilhelm Meisters Wanderjahre)
4. Antisemitismus in Werken von Pestalozzi
"Es war ein gesegnetes Dorf, aber Juden ... nisteten sich ein, wurden reich und das Dorf arm. Jetzt stehen die Kinder seiner ehemals gesegneten Häuser täglich als Bettler vor den harten Türen der Juden, und die armen Leute müssen in allweg tun, was die Judengasse will... Wo Juden und Judengenossen sich einnisten, da ist ausser der Judengasse kein Gemeingeist mehr denkbar..." (Pestalozzis sämtl Werke, Ausgabe Seyffarth 1901).
"Selber die ungöttliche Kunst und das alle reinen Fundamente der Wahrheit, Weisheit und Frömmigkeit misskennende Spielwerk des Talmuds ist mitten in seinem Unsinn ein äusserst merkwürdiges Denkmal der hohen gesetzgeberischen Kunst, durch welche das jüdische Volk zu einer, wenn auch noch so einseitigen und irregelenkten Ausbildung seiner Geisteskräfte hingeführt worden ist, beim sittlichen und religiösen Verderben dieses Volkes, dem letzten Bettlerjuden in den Erwerbsmitteln von Eigentum ein Übergewicht gibt, zu welchem der arme und eigentumslose Mann, der nicht Jude ist, in keinem Reiche der Welt noch gelangt ist." (Pestalozzis sämtl Werke, Ausgabe Seyffarth 1902).
Am 19. Juni 2000 erliess die Bezirksanwaltschaft Bülach eine Nichtanhandnahmeverfügung (Beilage 5).
Die vorliegende Verurteilung des BF wegen angeblich rassendiskriminierenden Äusserungen zum Schächten (Ziffer 4.9) stellt gegenüber dieser rechtskräftigen, von der Staatsanwaltschaft genehmigten Nichtanhandnahmeverfügung eine diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit dar (EMRK Artikel 14 iVm Artikel 10), aus folgenden Gründen:
Zu "Rätoromanisches Wörterbuch":
Die Bezirksanwaltschaft macht geltend, die Weiterverbreitung von Werken der Weltliteratur könne nich strafbar sein und inhaltlich sei der objektive Tatbestand der Rassendiskriminierung nicht erfüllt, "da weder die Menschenwürde gewisser Menschen oder Gruppen noch der öffentliche Friede durch die Zitate verletzt oder beeinträchtigt wird".
Die Gleichsetzung der Juden mit "Wucherer" ist zweifellos keine geringere Herabwürdigung als der Vorwurf der Lügenhaftigkeit (lit a der Anklage vom 28. April 2003). Die diskriminierende Ungleichbehandlung, je nachdem wer Verfasser ist, ist offensichtlich, umso mehr als der Vorwurf der Lügenhaftigkeit im Zusammenhang mit dem Schächten steht und sachlich belegt ist, die Gleichsetzung von Juden und Wucherer hingegen ein sachlich nicht belegtes antisemitisches Vorurteil ist.
Im übrigen kann nicht ohne Willkür behauptet werden, das Rätoromanische Wörterbuch zähle zur Weltliteratur, die Werke von Manfred Kyber (Ziffer VII der Anklageschrift vom 8. August 2000) jedoch nicht.
Zu "Antisemitismus in Werken von Goethe":
Die Behauptung der Bezirksanwaltschaft, die Weiterverbreitung von rassendiskriminierenden Texten der Weltliteratur sei straflos, entbehrt einer gesetzlichen Grundlage und stellt eine willkürliche Behauptung dar, beweist jedoch einmal mehr, dass die Strafbarkeit ganz eindeutig davon abhängt, WER einen Text verfasst hat, nicht was dieser beinhaltet. Das stellt eine willkürliche Ungleichbehandlung und Diskriminierung dar (EMRK 14 iVm 10). Ebenso diskriminierend ist die Beurteilung, die Bezeichnung der Juden als geldgieriges und feiges Volk, das "niemals viel getaugt" und "wenig Tugend und die meisten Fehler anderer Völker" besitzt, sei keine rassistische Herabwürdigung, die Bezeichnung der Schächtjuden als Lügner, weil sie die Schmerzhaftigkeit des Schächtens ableugnen, jedoch schon (lit a der Anklage vom 28. April 2003).
Zu "Antisemitismus in Werken von Pestalozzi":
Die Behauptung der Bezirksanwaltschaft, die Weiterverbreitung von rassendiskriminierenden Texten der Weltliteratur sei straflos, entbehrt einer gesetzlichen Grundlage und stellt eine willkürliche Behauptung dar, beweist jedoch einmal mehr, dass die Strafbarkeit ganz eindeutig davon abhängt, WER einen Text verfasst hat, nicht was dieser beinhaltet. Das stellt eine willkürliche Ungleichbehandlung und Diskriminierung dar (EMRK 14 iVm 10). Ebenso diskriminierend ist die Beurteilung, die Bezeichnung der Juden als asoziales, sittlich und religiös verderbtes Volk, sei keine rassistische Herabwürdigung, die Bezeichnung der Schächtjuden als Lügner, weil sie die Schmerzhaftigkeit des Schächtens ableugnen, jedoch schon (lit a der Anklage vom 28. April 2003).
Zu "Sonntags-Zeitung / Norman Finkelstein":
In der Nichtanhandnahmeverfügung (Seite 4) wird
festgestellt, mit dem Vorwurf der "Gaunerei" gegenüber gewissen jüdischen
Kreisen, würden diese nicht in ihrer Menschenwürde herabgesetzt.
Demgegenüber behauptet die Vorinstanz in casu, die Menschenwürde werde durch
den Vorwurf der Lügenhaftigkeit gegenüber gewissen jüdischen Kreisen, welche
die Schmerzhaftigkeit des Schächtens ableugnen, in tatbeständlicher Weise
herabgesetzt. Die diskriminierende Anwendung der Rassismusstrafnorm, je
nachdem WER etwas sagt, ist auch hier wieder offensichtlich.
4.8 Unsachlich? - Verfremdung als Stilmittel
Die Vorinstanz gesteht dem Angeklagten (Erwin Kessler) zu, dass er die inkriminierten Äusserungen aus tierschützerischen Motiven gemacht habe, wirft ihm aber vor (Seite 59), er sei mit diesen "weit über eine sachliche Kritik am Schächten" hinausgegangen. Das ist offensichtlich der entscheidende Grund für den Schuldspruch.
Was ist sachlich, was unsachlich? Die Vorinstanz hat nicht erläutert, was an den inkriminierten Äusserungen nicht sachlich sein soll, obwohl dies offensichtlich der urteilsentscheidende Punkt ist (Verletzung der Begründungspflicht). Der BF kann sich deshalb hier einmal mehr nur mit Mutmassungen darüber, was die Vorinstanz bei seiner Verurteilung gedacht hat, verteidigen.
Nicht jede scharfe Kritik ist unsachlich. Ob eine Äusserung unsachlich ist, hängt nicht davon ab, ob sie Betroffenheit auslöst oder schockiert, sondern davon, ob sie sachlich begründet ist. Die Kritik an den Schächtjuden ist jedenfalls sachlich begründet. Die Vorinstanz behauptet, der Vergleich mit Naziverbrechen sei unzulässig. Diese Behauptung ist willkürlich und tierverachtend, denn beide Vorinstanzen haben sich nicht im geringsten damit befasst, wie schlimm das betäubungslose Schächten ist.
Manche Leute finden es unsachlich, wenn jemand Emotionen hat, sich empört, wütend wird. In der heutigen, auf Macht und Profit ausgerichteten Gesellschaft gilt es als minderwertig, Emotionen zu haben - Anzeichen eines verweichlichten Charakters. Politisch korrekt ist es, Tiere als Sachen zu sehen und wie Sachen auszubeuten. Der Ständerat hat kürzlich beschlossen, einen Wirtschaftlichkeitsvorbehalt in das Tierschutzgesetz aufzunehmen. Der Bundesrat soll damit die Kompetenz erhalten, die Vorgaben des Tierschutzgesetzes in der Tierschutzverordnung nur soweit umzusetzen, wie dies die Agro- und Tierversuchsmafia als wirtschaftlich vertretbar erachtet. Das hat der Bundesrat schon bis heute so gemacht, neu ist dies nun auch noch legal. Ein vom Souverän mit überwältigender Mehrheit gutgeheissenes Gesetz wie das Tierschutz so zu sabotieren, ist politisch korrekt, erlaubt, straflos und sachlich. (Allerdings hat die vorberatende Kommission des Nationalrates auf Ersuchen des BF diesen Wirtschaftlichkeitsvorbehalt im Februar 2005 wieder gestrichen.)
Nachdem der Bundesrat mit seinem Ansinnen, das Schächtverbot aufzuheben, am breiten Widerstand in der Bevölkerung gescheitert ist, hat er sofort eine Gesetzesänderung ausgearbeitet, das es den Schächtjuden ausdrücklich erlaubt, das Schächtverbot durch den Import von Schächtfleisch aus Ländern, wo das Schächten noch erlaubt ist, zu umgehen. Das Parlament hat diesen Schildbürgerstreich sanktioniert. In der schweizerischen Demokratie so mit dem offenkundigen, grossmehrheitlichen Willen des Souveräns umzuspringen, gilt als "sachlich", politisch korrekt und erlaubt. Im Rechtsstaat Schweiz ist sekundär, wer sich rechtswidrig verhält und was jemand tut, entscheidend ist WER. Wenn sich der Bundesrat rechtswidrig verhält und den Volkswillen mit den Füssen tritt, ist das "sachlich", politisch korrekt, straflos. Wenn sich Tierschützer darüber empören, sind sie "unsachlich" und werden mit Staatsmacht diszipliniert.
Für einen kultivierten, ganzheitlich denkenden Menschen ist es nicht unsachlich, sich über Ungerechtigkeiten zu empören. Unsachlich ist, wer mit sachfremden Argumenten kämpft, zB wenn gewisse Medien - allen voran das Schweizer Fernsehen - gesetzwidrige, von Beamten gedeckte katastrophale Missstände in Schweine- und Hühnerfabriken systematisch unterdrückt werden mit dem Argument, der Tierschützer, der dies aufgedeckt habe, sei ein Antisemit. Unsachlich daran ist, das zwei Themen miteinander verknüpft werden, die nichts miteinander zu tun haben.
Der BF ist in seiner Kritik am Schächten und an den Schächtjuden nie unsachlich gewesen. Der Vergleich mit anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist nicht unsachlich. Grundsätzlich können Vergleiche hinken oder mehr oder weniger treffend sein, unsachlich sind sie deswegen noch nicht. Einen Sachverhalt mit einem anderen zu vergleichen, um etwas zu verdeutlichen, ist ein durchaus zulässiges rhetorisches Mittel.
Wenn einer gesellschaftliche Gruppe, die sich ständig und generationenlang als bemitleidenswerte Opfer eines historischen Verbrechens in Erinnerung ruft, ein Spiegel vorgehalten wird, der sie veranlassen soll, einmal über ihre eigenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachzudenken, anstatt sich immer nur als Opfer von Unmenschlichkeiten darzustellen, dann ist das in höchstem Grad sachlich, dh sachbezogen.
Dass es, um eingefleischte Gewohnheiten und Vorurteile zu ändern - hier die Auffassung: wir sind die Opfer, wir dürfen alles -, leise, unauffällige, diplomatische Worte nicht genügen, ist eine Erfahrungstatsache, die eigentlich auch beim Zürcher Obergericht nicht unbekannt sein sollte. Jedenfalls weiss das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und unterstellt deshalb in konstanter Praxis auch schockierende und störende Äusserungen der Meinungsäusserungsfreiheit.
Um Aufmerksamkeit für eine Aussage zu gewinnen, die sonst an den Vorurteilen und der Denkfaulheit des Lesers abprallt, bedient man sich in der Literatur des Stilmittels der Verfremdung. Dieses Stilmittel hat der BF beim Vergleich von Schächtjuden und Nazis eingesetzt. Damit hat er auf den ersten Blick unvereinbare Dinge miteinander verknüpft. Die dadurch erreichte Aufmerksamkeiten ist für den Leser eine Chancen, Zusammenhänge bewusst zu machen, die von Vorurteilen verdeckt waren.
Über das Stilmittel der Verfremdung steht in der Biografie von Bertold Brecht (Brecht in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Dargestellt von Marianne Kesting, rowohlts monographien) folgendes:
Das Verfahren, dessen Brecht sich bedient, ist ein grundsätzliches in seinem gesamten Werk; es findet sich nicht nur in der Lyrik, sondern auch im Drama, in der Regiearbeit, in der Prosa, ja, es lässt sich bis in einzelne Satzwendungen verfolgen. Zwei unstimmige oder absurde Situationen oder Bilder werden miteinander konfrontiert, sie rufen einen Schock, eine Verblüffung hervor, eine Verfremdung üblicher oder gewohnter Vorstellungen, wie Brecht es selber genannt hat. Ein oft angewandtes Mittel innerhalb moderner Dichtung, aber Brecht benutzt es nicht um seiner selbst willen, zur Darstellung des Absurden schlechthin, sondern um eine Situation als unstimmig zu kennzeichnen und die Frage nach der Lösung zu provozieren, auf eine Erkenntnis hinzuführen und, wie er es ausgedrückt hat, "um jenen fremden Blick zu entwickeln, mit dem der grosse Galilei einen ins Pendeln gekommenen Kronleuchter betrachtete. Den verwunderten diese Schwingungen, als hätte er sie so nicht erwartet und verstünde es nicht von ihnen, wodurch er dann auf die Gesetzmässigkeiten kam..." Es ist nicht zu übersehen, dass dieses Verfahren der Verfremdung dem der Ironie verwandt ist.
Im Jahr 1998, als der BF die inkriminierten Äusserungen veröffentlichte, war das Schächten noch weitgehend tabuisiert. Das Wort "Jude" war geradezu synonym mit "Opfer". Das normale Mitleidsverhalten neigt dazu, einem armen Opfer gefällig zu sein, sein Leiden durch Erfüllung seiner Wünsche zu lindern. Wer mag schon ein bedauernswertes Opfer zusätzlich verletzen? Da bestehen angeborene Hemmungen, welche von gewissen jüdischen Kreisen über Jahre und Jahrzehnte systematisch genährt und missbraucht wurden. Ein Mittel dazu sind zB die endlosen Wiederholungen von Fernsehsendung über die nationalsozialistische Judenverfolgungen. Das geht nun schon soweit, dass ein Schwarzweissfilm oder Schwarzweiss-Fotos, auf denen Stacheldraht zu sehen ist, sofort reflexartig das ganze Elend jener Verbrechen an den Juden in Erinnerung ruft. [Bemerkenswerterweise denkt dabei kaum jemand an andere Opfer der gleichen Geschichtsepoche (Intellektuelle, Widerstandskämpfer, Zigeuner und die Opfer Stalins), die weder zahlenmässig noch qualitativ weniger Schlimmes erlebt haben.] In dieser Situation war es ausserordentlich schwierig, Aufmerksamkeit für Unmenschlichkeiten, die durch diese "Opfer" heute selber begangen werden, zu finden. Verfremdung war das Mittel. Durch den inkriminierten Vergleich wurde der einprogrammierte, feststehende Gegensatz Juden-Nazis statt als Gegensatz plötzlich als eine Gemeinsamkeit dargestellt. Eine klassische Verfremdung.
Aber eine Verfremdung ist mehr als nur eine absurde Verbindung von nicht Zusammengehörendem. Eine Verfremdung verbindet etwas scheinbar Widersprüchliches, das bei genauerer Betrachtung zwar in der Regel nicht identisch ist, aber doch gewisse Gemeinsamkeiten aufweist, welche durch die Verfremdung bewusst gemacht werden sollen. Im Schächtjuden-Nazivergleich bestand die Gemeinsamkeit, wie der Leser ohne weiteres erkennen konnte, darin, dass Lebewesen bloss aufgrund ihrer Zuteilung zu einer bestimmten Kategorie zu wehrlosen Opfern gemacht werden. Die Nazis bedienten sich der Kategorie "Arier" bzw "Nichtarier". Die Schächtjuden rechtfertigen ihre unmenschlichen Folterungen dadurch, dass sie ihre Opfer der Kategorie "Nichtmensch" zuteilen. Auf diese auf Vorurteilen beruhende Katalogisierung ist sogar das Obergericht hereingefallen, indem es den Vergleich zwischen Verbrechen an Menschen und an Tieren im vornherein als unzulässig erachtet, obwohl alle wissenschaftlichen Tatsachen aus Biologie und Psychologie dafür sprechen, dass das Leiden von Menschen und anderen höheren Säugetier durchaus ähnlich ist. Mit der leider heute noch bei vielen Menschen, nicht nur den Schächtjuden, vorherrschenden Einstellung, der Mensch stehe über den Tieren und menschliche Interessen hätten vor tierlichen stets den Vorrang, wird auf einen Schlag alles erlaubt, die schlimmsten Ausbeutungen, die grausamsten Folterungen, wenn sie nur irgend einem (religiösen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen) Zweck dienlich scheinen. So schrieb zum Beispiel der Basler Rabbiner Israel Levinger - der extra ein Buch herausgegeben hat, um die Qualen beim Schächten zu verharmlosen - im Israelitischen Wochenblatt (Beilage 10 zum Plädoyer vom 7. November 2001):
...wo ein Bedürfnis für den Menschen besteht, existiert kein Verbot der Tierquälerei
Plumper und skrupelloser kann der anthropozentrische Egoismus kaum mehr formuliert werden. Ähnlich werden Nazis in bezug auf ihre nichtarischen Opfer gedacht haben.
Der Verurteilung des BF liegt die Auffassung der verantwortlichen Oberrichter zu Grunde, der Vergleich der Schächtjuden mit Nazi-Verbrechern, eines Massenverbrechens an Tieren mit dem Massenverbrechen an Menschen, der Schächt-Ideologie mit der Arier-Ideologie sei antisemitisch. Diese Vergleiche mögen manche Menschen schockieren. Das ist gewollt, das ist eben nötig, das ist das Stilmittel der Verfremdung: Scheinbar nicht Zusammengehörendes wird miteinander verbunden. Der Widerspruch ist aber nur scheinbar, ein Vorurteil. Betrachtet man die Sache objektiv, aus moderner biologischer Sicht, dann ist es nicht gerechtfertigt anzunehmen, ein höheres Säugetier erleide weniger Schmerz und Todesangst als ein Mensch, wenn ihm bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten wird. Aus moderner ethischer Sicht ist es deshalb auch nicht gerechtfertigt, dieses Leiden grundsätzlich anders zu werten und einen grundsätzlichen Unterschied zu machen, je nachdem ob die Opfer Menschen oder Nichtmenschen sind.
Goetschel/Bolliger: Das Tier im Recht, orell füssli Verlag, Seite 196:
Die Forderung nach Tierrechten lässt sich weit zurückverfolgen und beruht auf einer betont sachlichen Auseinandersetzung über den moralischen Status von Tieren. Auf der Ansicht aufbauend, dass sich Tiere vom Menschen lediglich in gradueller Hinsicht unterscheiden, ist es für Vertreter der Tierrechtstheorie allein eine Frage der Menschheitsentwicklung, bis Tiere dereinst einmal als rechtsfähige Subjekte anerkannt sein werden. Exemplarisch verwiesen wird dabei auf die juristische Befreiung der Frauen, Kinder, Fremden und Sklaven, die ihre heute unbestrittenen Personenrechte alle ebenfalls erst in einem langen historischen Prozess und gegen anfänglich heftige gesellschaftliche Widerstände erwarben.
Noch allzuviele Menschen machen einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Schmerz empfindsamer, leidensfähiger Lebewesen, je nachdem sie zwei oder vier Beine haben, so wie eine frühere Menschheit einen grundsätzlichen Unterschied gemacht hat, je nachdem die Haut von Menschen weiss oder schwarz war, je nachdem ob es sich um einen Arier oder Nicht-Arier handelte... Solche tradierte Vorurteile sitzen tief. Es muss in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft erlaubt sein, gegen solch verhängnisvolle Vorurteile und ihre Folgen - das hier und jetzt in Europa und auf der ganzen Welt weitergehende Massenverbrechen an den Nutztieren - mit provokativ-aufrüttelnden Vergleichen, nicht nur ungehört zurückhaltend "sachlich", anzugehen.
Im ersten Schächtprozess hat der Obergerichtspräsident, Dr E Brunner, dem
Angeklagten an der Hauptverhandlung vorgeworfen, seine Kritik am
betäubungslosen Schächten sei grobschlächtig. Da hat er den Nagel auf
den Kopf getroffen: Das Schächten ist wahrlich ein grobes Schlachten.
Höflich mit dem Pack? Mit Seide näht man keinen groben Sack!
Goethe
Die Schweiz des 21. Jahrhunderts ist mit ihrer nationalen Antirassismus-Neurose zu Inquisition und Bücherverbrennung zurückgekehrt und weit von ihrem historischen Freiheitsideal abgekommen: Anpassung an das Ausland und staatliche Sprachregelung mit dem Strafgesetzbuch sind das heutige eidgenössische Markenzeichen. Die Meinungsäusserungsfreiheit wird in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes fast immer anderen (wirtschaftlichen und politischen) Interessen untergeordnet, weshalb es immer häufiger zu Verurteilungen der Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt.
Grausamkeit gegen die Tiere ist eines der kennzeichnendsten Laster eines niederen und unedlen Volkes. Wo man ihrer gewahr wird, ist es ein sicheres Zeichen der Unwissenheit und Rohheit, welche selbst durch alle Zeichen des Reichtums und der Pracht nicht übertüncht werden kann. Grausamkeit gegen Tiere kann weder bei wahrer Bildung, noch bei wahrer Gelehrsamkeit bestehen.
Alexander von Humboldt (zitiert nach Manfred Kyber, Tierschutz und Kultur)
Wenn der BF (Erwin Kessler) ein Rassist ist, dann ist der bekannte Humanist Alexander von Humboldt auch einer. Das jedoch qualifiziert weder Alexander Humboldt noch den BF, sondern diesen Unrechtsstaat, der die Justiz als Mittel der Politik einsetzt, um Kritiker, die sich für Humanität gegenüber Wehrlosen und Gefolterten einsetzen, mundtot zu machen.
4.9 Die einzelnen Äusserungen zum Schächten
Richard Wagner (zitiert nach Manfred Kyber, Tierschutz und Kultur, Seite 16)"Was erwarten wir von einer Religion, wenn wir das Mitleid mit den Tieren ausschliessen?"
Abkürzung: Mit "BGE X c. A" wird im folgenden auf den Entscheid des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 10.6.1996 in Sachen X c. A verwiesen.
4.9.1 Zur Anklageschrift vom 8. August 2000
Zu Ziff II der Anklageschrift vom 8. August 2000
Die Anklageschrift bezeichnet folgende Sätze aus der Veröffentlichung www.vgt.ch/news_bis2001/981208.htm als rassendiskriminierend:
... Meine Kritik an den Schächtjuden ist mit der berechtigten Kritik an Nazis zu vergleichen: In beiden Fällen wird ein unmenschliches Verhalten scharf verurteilt und als Unmenschlichkeit dargestellt. Die Betroffenen - Nazis bzw Schächtjuden - werden zu Recht öffentlich als Unmenschen dargestellt....... dass ich als prominenter Tierschützer das Schächten als abscheuliche Tierquälerei, vergleichbar mit den Untaten von Nazi-Verbrechern, verurteile.
Die Vorinstanz führt dazu aus (Seite 55), mit dem Vorwurf von Unmenschlichkeit und unmenschlichem Verhalten würde den Schächtjuden die Menschenwürde abgesprochen.
Ob ein Mensch, der sich unmenschlich verhält, Menschenwürde hat, ist eine philosophische Frage. Jedenfalls bleibt schleierhaft, wie die Vorinstanz aus dem Vorwurf von unmenschlichem Verhalten zwingend ein Absprechen der Menschenwürde ableiten kann. Diese entscheidende Deutung hat die Vorinstanz nicht begründet, weil es für willkürliche Behauptungen eben keine sachliche Begründung gibt. Stattdessen behauptet die Vorinstanz wahrheitswidrig, der Angeklagte habe den Schächtjuden "ausdrücklich" die Menschenwürde abgesprochen (Seite 55, 3.b). Diese Behauptung ist aktenwidrig und stellt eine willkürliche Beweiswürdigung dar - beides sind absolute Nichtigkeitsgründe, weshalb das vorinstanzliche Urteil aufzuheben ist.
Gemäss BGE X c. A "darf nicht leichthin angenommen werden, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Indem die Vorinstanz ohne jede Begründung unterstellt, der Leser verstehe die inkriminierte Veröffentlichung dahingegehend, der BF spreche den Schächtjuden die Menschenwürde ab, hat sie sich grundlos und damit willkürlich über diese konstante, im angegebenen Entscheid bestätigte Bundesgerichtspraxis hinweggesetzt und Bundesrecht falsch angewendet.
Der Angeklagte setzt sich mit seinem tierschützerischen Kampf gegen das Schächten eben gerade für Menschenwürde ein, denn Tiere grausam zu quälen - egal ob aus religiösen oder profanen Motiven - ist mit Menschlichkeit und Menschenwürde unvereinbar. Der deutsche Jude Samuel Dombrowski, Träger des Ehrenkreuzes der Akademie für Tierschutz des Deutschen Tierschutzbundes, führte dazu auf dem 3. Interdisziplinären Symposium "Tiere ohne Recht?", Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, 26.3.98-28.3.98, sehr treffend folgendes aus:
Bereits bei der Vorbereitung des Fesselns und des Werfens, vor allem aber beim Schächten selbst, erleidet das unbetäubte Tier Todesangst, unsägliche Leiden und Schmerzen. Ein schmerzempfindliches Wesen von diesen unnötigen Zumutungen zu verschonen, muss als ein höher einzustufendes Rechtsgut bewertet werden als irgend ein religiöses Konstrukt oder Ritual, dessen Sinn nicht oder nicht mehr nachzuvollziehen ist.
Der Schnitt durch die Hals-Weichteile ist äusserst schmerzhaft. Es werden dabei nur zwei der insgesamt sechs Halsarterien durchtrennt, die das Gehirn versorgen. Das hat seine fast unverminderte Durchblutung zur Folge... Aus der durchtrennten Speiseröhre wird der Mageninhalt aspiriert und Hustenreiz ausgelöst, was die Schmerzen durch Atemnot und die Erstickungsangst verstärkt. Diese panische Angst ist an den Augen des Tieres gut erkennbar für jeden, der dem Schächtablauf einmal beigewohnt hat.
Deshalb stelle ich fest: Es gibt keinen plausiblen Grund dafür, den Tieren bei vollem Bewusstsein und uneingeschränkter Schmerzempfindung einen solch qualvollen und langsamen Tod zu bereiten. Kein Gott, welcher Religion auch immer, kann so grausam sein, zu fordern, dass seine Geschöpfe 'ihm zu Ehren' auf diese Weise gequält werden! Das kann in keiner von ihm stammenden Mitteilung enthalten sein! Es sind von Menschen erdachte Ritual-Morde an der wehrlosen Kreatur, die als Irrwege bezeichnet werden müssen und niemals gottgefällig sein können. In allen Religionen wird Schutz und schonender Umgang mit den Tieren gefordert; wohlgemerkt: Religionen und nicht Religions-Interpretationen.
Wenn ich ... richtig verstehe, wird mit dem Holocaust der Juden nunmehr der Holocaust der Tiere gerechtfertigt.
Es wäre endlich an der Zeit, das betäubungslose Schächten der Tiere als Unrecht sowie als würdeloses und beschämendes Fehlverhalten der Menschen zu erkennen, wie es mit dem Religionsgesetz des Zu-Tode-Steinigens, den Hexenverbrennungen, der Inquisition und der Sklaverei geschah. Wenn menschliche Ansprüche und religiöse Forderungen in Gegensatz zur Menschenwürde geraten, sind wir auf Grund der Geschichtserkenntnis alle aufgerufen, der Menschenwürde zum Durchbruch zu verhelfen... Es wäre die Pflicht eines jeden von ethischen Grundsätzen geleiteten und von Mitgefühl und Tierliebe geprägten Menschen, seine Stimme gegen dieses himmelschreiende Unrecht an der Kreatur zu erheben... Wir alle, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, müssen stark und konsequent bleiben, damit die stumme, leidende Tierwelt nicht ihre Fürsprecher und die Menschheit ihre Menschenwürde verliert!
Adresse des Autors: Samuel Dombrowski, Julius-Rietz-Strasse 18, D-40593 Düsseldorf.
Ganz in diesem Sinne setzt sich der BF (Erwin Kessler) dafür ein, der Menschenwürde zum Durchbruch zu verhelfen.
Weiter behauptet die Vorinstanz (Seite 55/56), indem der Angeklagte die Tierfolter der Schächtjuden mit Nazi-Verbrechen vergleiche, stelle er die Schächtjuden auf eine Stufen mit den Anhängern eines verbrecherischen Systems, was den Tatbestand der Rassendiskriminierung erfülle. Unter Verletzung der Begründungspflicht erläutert die Vorinstanz mit keinem Wort, warum es rassendiskriminierend sein soll, wenn das unmenschliche Verhalten einer Gruppe mit dem unmenschlichen Verhalten einer anderen Gruppe verglichen wird. Die fehlende Begründung verunmöglicht es dem BF, die vorliegende Beschwerde in diesem Punkt gezielt und wirksam zu begründen. Diese Behinderung der Verteidigungsrechte durch Verletzung der Begründungspflicht in einem wichtigen, urteilsentscheidenden Punkt stellt einen absoluten Nichtigkeitsgrund dar (Verletzung von EMRK 6).
Dem BF bleibt nichts anderes übrig, als in diesem Punkt über die nicht offengelegten Erwägungen der Vorinstanz zu spekulieren (was eben die Verteidigung unzulässig behindert). Soweit ersichtlich, muss die vorinstanzliche Beurteilung auf einer der folgenden zwei verschiedene Auffassungen beruhen:
a) Grundsätzlich dürfe niemandem die Menschenwürde abgesprochen werden. Dieses Argument führt aber in casu zu einem Widerspruch, denn durch den Vergleich des unmenschlichen Verhaltens von Schächtjuden und Nazis wird ersteren nur die Menschenwürde abgesprochen werden, wenn zuvor den Nazis die Menschenwürde abgesprochen wird. Das Gericht müsste also die Auffassung vertreten, Nazis hätten keine Menschenwürde, was aber der Auffassung widerspricht, niemandem dürfe die Menschenwürde abgesprochen werden.
b) Falls lit a wegen der aufgezeigten Widersprüchlichkeit nicht zutrifft, kann logisch nur das Gegenteil zutreffen: Das Gericht ist also der Auffassung, dass Unmenschen, insbesondere Nazis, die Menschenwürde abgesprochen werden dürfe. Dieser Auffassung ist auch Schiller:
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,
Bewahret sie
sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Warum es dann aber verboten und strafbar sein soll, auch den Schächtjuden die Menschenwürde abzusprechen, hat das Gericht nicht begründet, obwohl urteilsentscheidend. Wegen dieser die Wahrnehmung der Verteidigungsrechte behindernden Verletzung der Begründungspflicht ist es dem BF wiederum nur möglich, über die der Verurteilung zugrundeliegende Auffassung der Vorinstanz Mutmassungen anzustellen. Diese gehen dahin, die Vorinstanz betrachte das Schächten nicht als grausame Unmenschlichkeit. Das widerspricht aber derart krass den heute bekannten und von Fachleuten, zB der Schweizerischen Tierärztegesellschaft, anerkannten Fakten, dass die Vorinstanz damit in Willkür verfallen ist (ein absoluter Nichtigkeitsgrund). Allein schon das Vorgehen bei der Beweiswürdigung - willkürliche Annahmen treffen, anstatt von Fakten auszugehen - ist ein Nichtigkeitsgrund.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist nicht der Ort, über die Grausamkeit des Schächtens Beweis zu führen, da dies im Nichtigkeitsverfahren prozessrechtlich unzulässig sind. Im übrigen hat nach geltendem Recht der Staat die Pflicht, die Schuld des Angeklagten nachzuweisen, nicht dieser seine Unschuld. Das Gericht hätte deshalb begründen müssen, weshalb es das Schächten im Widerspruch zu der unter Fachleuten und in der Bevölkerung grossmehrheitlich vorherrschenden Auffassung als nicht unmenschlich bzw weniger unmenschlich als Nazigreuel beurteilt. Weil das Gericht nicht in der Lage war diese seine Auffassung zu begründen, beruht das Urteil auf einer willkürlichen Sachverhaltsfeststellung bzw Beweiswürdigung - ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
Das Verfahren ist aus diesem Grund an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese hat bei der Wiederholung des Verfahrens eine wirksame materiellle Verteidigung des Angeklagten zu ermöglichen.
Da ausser den Schächtjuden selber praktisch niemand die Grausamkeit des Schächtens bestreitet, scheint es wahrscheinlich, dass auch die Vorinstanz dies nicht bestreit, jedoch der Auffasung ist, das Leiden von Tieren und Menschen sei qualitativ derart verschieden, dass ein Vergleich im vornherein unzulässig sei. Dies wäre indessen wiederum eine unhaltbare, willkürliche Annahme (ein absoluter Nichtigkeitsgrund) ohne jede objektive Basis. Im Gegenteil deutet alles, was heute aus Naturwissenschaft und Tierpsychologie bekannt ist, zwingend darauf hin, dass höhere Säugetiere Freude, Leiden, Angst und Qualen sehr ähnlich erleben wie das Säugetier Mensch. Dies ist besonders augenfällig und auch von Laien relativ leicht zu beobachten beim Vergleich von Kleinkindern mit höheren Säugetieren (zB Hunde oder Katzen).
Vielleicht (dies lässt sich wegen der Verletzung der Begründungspflicht wiederum nur vermuten) stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, darauf komme es überhaupt nicht an, jede noch so bestialische Tierquälerei berühre die Menschenwürde nicht, es seien ja nur Tiere.
Diese Auffassung ist tatsächlich in kulturell und ethisch niederen Gesellschaftsschichten leider allzu oft anzutreffen und das ist der Hauptgrund, dass in unserem Land Millionen von leidensfähigen Tieren gewerbsmässig gequälet werden, mit Duldung und Unterstützung durch die Behörden.
Wenn die Verurteilung des BF - was leider angenommen werden muss - auf einer solchen niederen Gesinnung der Oberrichter beruht, dann gute Nacht Schweiz. Die Barbaren haben das Abendland wieder zurückgewonnen.
Der BF hat Videoaufnahmen von jüdischem Schächten zu den Akten gegeben. Vermutlich haben es sich die vorinstanzlichen Richter erspart, diese unerträglichen Aufnahmen anzusehen, bei denen es sogar mit dem BF befreundetehn Jägern und Ärzten schlecht geworden ist. Umso unbeschwerter konnten sie dann tun, was sie für politisch opportun hielten: den politisch unbequemen BF koste es was es wolle zu verurteilen.
Auf dem Video, das die vorinstanzlichen Richter feige nicht angesehen haben, ist folgendes zu sehen:
Das Video zeigt das Schächten von zwei Kühen, ein Ausschnitt aus der Routinearbeit eines modernen, mechanisierten jüdischen Schlachthofes in England.
Die Direktorin der Vegetarier-Vereinigung Viva, eine Zoologin, schreibt zu diesen Aufnahmen (Going for the Kill - Viva-Report on Religious Slaughter, by Juliet Gellateley BSc (Zoology), Director of Viva, Brighton, 1998):
"Viva hat eine offiziell gefilmte Videodokumentation erhalten über das Schächten zweier Kühe nach der jüdischen Schlachtmethode. Viva wurde bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, dass Kühe durch einen einzigen Schnitt quer durch den Hals getötet würden und dass das Tier fast augenblicklich das Bewusstsein verlieren würde, was jedoch nicht zutrifft.
Fall 1:
Der Hals der Kuh wird durch eine mechanische Hebevorrichtung gestreckt durch Aufwärtsdrücken des Kopfes. Die Nüstern der Kuh vibrieren. Starrer Blick. Schäumender Speichel fliesst aus dem Maul. Der Schächter schneided die Kehle der Kuh durch, indem er 13 mal hin und her säbelt. Die Kuh zuckt vom Messer zurück soweit sie kann und ihr Ausdruck zeigt Schmerz und grosse Angst. Die Kuh verliert das Bewusstsein nicht sofort; der Film endet vorher.Fall 2:
Wieder wird der Hals der Kuh gestreckt und der Kopf mechanisch aufwärts gedrückt. Die Kuh steht dabei aufrecht in einer Box. Nach drei Schnitten strömt das Blut heraus; der mechanische Halsstrecker wird gelöst, aber das Tier verliert das Bewusstsein nicht. Es ist deutlich bei vollem Bewusstsein während das Blut aus der klaffenden Wunde strömt. Seine Augen blicken und blinken, es bewegt seine Ohren und es hält seinen Kopf aufrecht. Nach 30 Sekunden wird auf der Stirne ein Bolzenschuss angesetzt, aber die Kuh verliert das Bewusstsein immer noch nicht. Sie schafft es immer noch, ihren Kopf frei aufrecht zu halten, als der Film nach 50 Sekunden endet."Nach dem Durchsäbeln des Halses schiesst ein Blutschwall hervor, der bald zu stocken beginnt. Hierauf greift der Schächter mit der Hand in die klaffende Wunde der Kuh, die bei vollem Bewusstsein ist, um das Blut wieder zum Fliessen zu bringen. Am Ende der ganzen Videosequenz macht die Kuh nach der ganzen Prozedur - Schächtschnitte und Bolzenschuss - sogar noch einen Schritt zurück, gerade noch sichtbar, bevor der Film abbricht. Für den Bolzenschuss werden zu schwache Ladungen verwendet, damit das Tier nicht getötet wird, weil die Tiere angeblich gemäss Religionsvorschrift lebend geschächtet werden müssen. Im Videofilm ist die Ladung offenbar so schwach, dass die Kuh nicht einmal momentan bewusstlos wird, sondern nur von Schmerz gepeinigt die Augen zukneift - eine satanische Schlachtmethode im Namen Gottes!
Ähnliches hat eine Delegation des Schweizerischen Tierschutzverbandes im Schlachthof in St Louis (Frankreich) beobachtet, von wo das jüdische Schächtfleisch in die Schweiz importiert wird. Die ausserordentliche Bestialität des Schächtens ist - für alle, die es wissen wollen - genügend dokumentiert. Der BF selber hat das bestialische Schächten im Schlachthof in Wien aus nächster Nähe beobachte und ist aufgrund dieser Erfahrung nicht bereit, sich von verlogenen Schächtjuden und Freisler-Richtern (www.swiss1.net/datapool/persons/freisler) sagen zu lassen, diese Massenverbrechen an höheren Säugetieren dürften nicht als Unmenschlichkeit bezeichnet werden!
Nach Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3. Auflage, Seite 219, ist für den subjektiven Tatbestand der Wille des Täters erforderlich, "mit seinem Verhalten jemanden oder eine Personenmehrheit unter Berufung auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, Rasse oder Religion herabzusetzen...". Der BF hat hier ganz offensichtlich die Schächtjuden kritisiert weil sie Tiere quälen, nicht weil sie zum Judentum gehören. Die vorinstanzliche Verurteilung, obwohl der subjektive Tatbestand nicht erfüllt ist, ist willkürlich und verletzt die bundesrechtlichen Voraussetzungen der Strafbarkeit.
Zu Ziffer III der Anklageschrift vom 8. August 2000
Unter dieser Ziffer bezeichnet die Anklageschrift folgende Textstellen aus der Veröffentlichung www.vgt.ch/news_bis2001/981114.htm als rassendiskriminierend:
Nur eine ganz spezielle Volksgruppe ist immun vor solchen Verfolgungen - ausgerechnet eine Volksgruppe, welche in ihren Büchern die allerschlimmsten rassistischen Weltanschauungen verbreitet. Authentische Zitate aus ihrem "Talmud" genannten Bekenntnis, in welchem man - wie damals in Hitlers "Mein Kampf" - ihre rassistischen Theorien ganz offen nachlesen kann...
Und wie die heute von den Juden solidarisch verteidigte grausame Schächt-Tradition zeigt, wird an abartigen Vorstellungen aus uralten jüdischen Traditionen auch heute noch zäh festgehalten.
Der BF hat diese Feststellungen in der inkriminierten Publikation (www.vgt.ch/news_bis2001/981114.htm) sachlich begründet und die angesprochenen Zitate aus dem Talmud wörtlich wiedergegeben:
[gemeint sind die Juden] seid meine Schafe..., Menschen seid ihr. D.h. ihr heisst Menschen, die [weltlichen] Völker [aber] nicht Menschen.""Wer die Scharen der Nichtjuden sieht, spreche: Beschämt ist Eure Mutter, zu Schande, die euch geboren hat."
"Wer die Gräber der Nichtjuden sieht, spreche: Beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat."
"Wenn ein Nichtjude oder ein Sklave einer Israelitin beiwohnt, so ist das Kind ein Hurenkind."
"Unter Hure sind nur die Proselytin (die Nichtjüdin), die freigelassene Sklavin und die in Unzucht Beschlafene zu verstehen."
"Ihr aber
"Wenn der Ochse eines Israeliten den Ochsen eines Nichtjuden niedergestossen hat, so ist er ersatzfrei."
"Die Beraubung eines Bruders [Israeliten] ist nicht erlaubt, die Beraubung eines Nichtjuden ist erlaubt..."
"Die Güter der Nichtjuden gleichen der Wüste, sind wie ein herrenloses Gut und jeder, der zuerst von ihnen Besitz nimmt, erwirbt sie."
"Es wird bezüglich des Raubes gelehrt: Diebstahl, Raub und Raub einer schönen Frau und desgleichen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten, und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Das Blutvergiessen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt."
Kein vernünftiger Mensch wird behaupten, das sei keine verabscheuungswürdige rassistische Theorie.
Der jüdische Buchautor Pascal Krauthammer hat in seinem Buch "Das Schächtverbot in der Schweiz" behauptet, obige Zitate seien gefälscht. Der BF hat diese jedoch vor der Veröffentlichung sorgfältig anhand des Originaltalmud in schweizerischen Universitätsbibliotheken verifiziert und verlangte in einer Persönlichkeitsschutzklage gegen den Buchautor die gerichtliche Feststellung, dass der Fälschungsvorwurf unwahr sei, was die erste Instanz im zur Zeit hängigen Verfahren denn auch so festgestellt hat. Die Weiterverbreitung des Buches ist vorsorglich verboten und das Verfahren zur Zeit vor dem Thurgauer Obergericht hängig. Im Rahmen dieses Verfahrens musste Krauthammer nämlich zugeben, dass diese Zitate nicht gefälscht sind. Er habe mit dem Fälschungsvorwurf nicht den BF und dessen Zitate gemeint, sondern Tierschützer früherer Generationen (welche, wie der BF nachgewiesen hat, auch keine Talmud-Zitate gefälscht haben).
Die Vorinstanz weicht dieser Tatsache aus - es geht offensichtlich nicht um Rechtsprechung, sondern um die politische Disziplinierung eines unbequemen Kritikers mit dem Mittel der Justiz -, indem sie behauptet (Seite 57):
Selbst wenn derlei tatsächlich im Talmud stehen sollte...
Mit dieser Floskel ersparte sich die Vorinstanz die beschwerlichere Suche nach der Wahrheit, was in der Geschichtsschreibung über den Holocaust an den Nutztieren gewiss nicht zu ihrer richterlichen Ehre gereichen wird.
Die Vorinstanz behauptet sodann (Seite 57):
Selbst wenn derlei tatsächlich im Talmud stehen sollte, wäre unzweifelhaft, dass es sich dabei um uralte Texte aus einer Zeit handelte, als solche Vorstellungen noch bei vielen Völkern verbreitet waren. Die Behauptung des Angeklagten, dass das heutige Judentum an solchen - in der Tat rassistischen - Ideen festhalte, ist schlicht absurd.
Die Vorinstanz räumt damit ein, dass diese Talmud-Zitate zu Recht als rassistisch bezeichnet werden können. Sie behauptet zu Recht nicht, dieser Rassismus sei entscheidend harmloser als die nationalsozialistische Rassentheorie. Statt dessen behauptet die Vorinstanz ohne Begründung (Verletzung der Begründungspflicht), diese talmudischen Lehren hätten für das heutige Judentum keinerlei Bedeutung mehr, die gegenteilige Behauptung des BF sei "schlicht absurd" (Seite 57). Diese Behauptung entbehrt jeder obejektiven Grundlage und widerspricht den Fakten (siehe unten) und stellt deshalb eine willkürliche Beweiswürdigung dar - ein absoluter Nichtigkeitsgrund.
Die Glaubensgrundlage des Judentums ist die Thora. Der Talmud legt die Thora aus und erläutert sie. Der Talmud ist bis heute die für das Judentum massgebliche religiöse Schrift, die in den Talmudschulen gelehrt wird. Die oben zitierten rassistischen Lehren wurden bis heute nicht fallen gelassen oder auch nur relativiert. Sie finden sich in den aktuellen Talmud-Ausgaben, wie sie heute im Buchhandel und in Bibliotheken zugänglich sind. Die vorinstanzliche Behauptung, an diesen talmudischen Lehren würde heute nicht mehr festgehalten, entbehrt jeder Grundlage.
Im Gegenteil gibt es objektive Belege für die inkriminierte Äusserung, dass "an abartigen Vorstellungen aus uralten jüdischen Traditionen auch heute noch zäh festgehalten" wird:
a) Betäubungsloses Schlachten (Schächten)
Das Schächten ist kein religiöses Ritual (siehe Ziffer 4.3.5). Die jüdische Religion verpflichtet die Gläubigen nicht, Tiere zu schächten und Schächtfleisch zu essen. Es handelt sich lediglich um eine Methode der Fleischgewinnung für diejenigen jüdischen Individuen, die Fleisch essen wollen, obwohl es heute eine wissenschaftlich feststehende Tatsache ist, dass vegetarische Ernährung gesünder ist. Mit modenen Schlachtmethoden kann heute eine optimale Entblutung des Schlachtkörpers - in früheren Zeiten das Hauptmotiv für das Schächten - eindeutig besser sichergestellt werden, als durch das Schächten. Dies ist wissenschaftlich erwiesen und unbestritten. Unter diesen Umständen an einer völlig überflüssigen, grausamen Tierquälerei festzuhalten, muss als Abartigkeit beurteilt werden dürfen, ebenso wie andere im Talmud gelehrte Abartigkeiten, die früher wohl auch einmal als völlig normal und "religiös begründet" galten, und auch ebenso wie ähnliche "Traditionen" anderer Religionen bzw Ethnien wie etwa das grausame Beschneiden von Mädchen oder das Steinigen von Ehebrecherinnen.
b) Nichtjuden sind keine Menschen
Wie orthodoxe Juden heute den im Talmud festgeschriebenen krassen Rassismus aktuell leben, zeigte der folgende Bericht im Tages-Anzeiger (Beilage 16 zum Plädoyer zur ersten erstinstanzlichen Verhandlung vom 7. November 2001):
Aussagen von Rabbinern... verdeutlichen die menschenfeindliche Haltung der Messianisten, die Nichtjuden theologisch ihr Menschsein absprechen und Frauen sowie die Säkularen insgesamt als niedere Wesen betrachten. ... gilt für den Messianisten, das Volk Israel vom 'unreinen Mischvolk' zu befreien: zu diesen 'satanischen Kräften' werden auch die ungläubigen Juden gezählt.
Und in der Weltwoche Nr 2.03 wird unter dem Titel "Palästeninenser sind Tiere" ein israelischer Soldat zitiert (Seite 38): "Das Land gehört uns, und die Palästinenser sind Tiere." - eben was der Talmud lehrt.
Das ist die - von der schweizerischen Öffentlichkeit bis heut kaum wahrgenommene - Realität der jüdischen Orthodoxie. Warum wurde gegen den Redaktor des Tages-Anzeigers, der dies veröffentlicht hat, nicht Anklage erhoben? Weil es nicht darum geht, WAS gesagt wird, sondern WER es sagt (diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit, EMRK 14 iVm 10).
c) Folterung von Nichtjuden in Israel
In der NZZ vom 12.1.1998 war die folgende kleine, unscheinbare Meldung zu lesen, die Einblick gibt, wie sich der talmudische Rassismus - an dem laut Obergericht angeblich niemand mehr festhält - gegenüber Nichtjuden aktuell auswirkt:
Erlaubnis zur Folterung eines Häftlings in Israel.
Das Oberste Gericht Israels hat am Sonntag mit fünf gegen vier Stimmen entschieden, dass der Geheimdienst beim Verhör des mutmasslichen Terroristenführers Abdel Rahmans Ranimat physischen Druck anwenden darf. ... Bezeichnend ist, dass das Urteil nicht bloss von gemässigtem Druck spricht, der zum Beispiel Schlafentzug, Fesselung mit Hand- und Fussschellen, heftiges Schütteln oder die Stülpung eines Sackes über den Kopf umfasst, da solches dem Geheimdienst ja sowieso gestattet ist....
Hier zeigt sich, wie die diskriminierenden talmudischen Lehren heute noch bis in die höchste Politik und in die höchsten israelischen Gerichte hinauf weiterleben. Es zeigt sich aber auch mit aller Deutlichkeit, wohin eine falsch verstandene religiöse Toleranz, wie sie Bundesrätin Dreifuss propagiert, führen kann. Wer die Vergleiche des Schächtens mit Naziverbrechen ablehnt, weil ja "nur" Tiere die Opfer sind, ist erschreckend nahe daran, auch die in Israel staatlich erlaubte und praktizierte Folter mit den Worten abzutun, es gehe dort ja "nur" um Palästinenser.
Spätestens hier sollte jeder vernünftige Mensch die Nazi-Mentalität erkennen, die in der Einstellung steckt, "es sind ja nur Tiere".
Dazu schrieb der aus Nazi-Deutschland geflohen jüdische Buchautor Isaac Bashevis Singer:
Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka.
und weiter (in seinem Buch "Der Büsser"):
Ich beobachtete, wie sich jemand am Nachbartisch über eine Portion Schinken mit Eiern hermachte. Ich war längst zu der Überzeugung gelangt, dass die Art und Weise, wie der Mensch mit den Geschöpfen Gottes umgeht, seinen Idealen und dem ganzen sogenannten Humanismus Hohn spricht. Damit dieser vollgefressene Kerl sich an Schinken delektieren konnte, musste ein Lebewesen aufgezogen, zur Schlachtbank gezerrt, gequält, abgestochen und mit kochendem Wasser abgebrüht werden. Dieser Mensch kam gar nicht auf den Gedanken, dass das Schwein aus dem gleichen Stoff geschaffen war wie er selbst und dass es leiden und sterben musste, bloss damit er das Fleisch verzehren konnte. "Wenn es um Tiere geht", habe ich mir schon oft gedacht, "ist jeder Mensch ein Nazi." ...
Der erste Entschluss, den ich fasste, hatte eigentlich nichts mit Religion zu tun, aber für mich war es ein religiöser Entschluss. Nämlich: kein Fleisch und keinen Fisch mehr zu essen - nichts, was einmal lebendig gewesen und zu Ernährungszwecken getötet worden war. Schon als Geschäftsmann, der reich werden wollte, schon als ich andere und auch mich selbst betrog, hatte ich gespürt, dass ich gegen meine Überzeugung lebte und dass meine Lebensweise verlogen und verderbt war. Ich war ein Lügner, obwohl ich Lug und Trug verabscheute...
Ich habe genug gelernt, um zu wissen, dass die Thora das Fleischessen als "notwendiges Übel" betrachtet. Die Thora spricht verächtlich von denen, die sich nach den Fleischtöpfen sehnen.
d) Rassismus und Abartigkeiten des aktuell gelebten ultra-orthodoxen Judentums
Dazu einige Zitate aus dem Buch "Jüdische Geschichte, jüdische Religion" von Prof Israel Shahak, einem israelischen Juden, der gegen die menschenrechtswidrige Diskriminierung der Palästinenser kämpfte. (Das Buch wurde im ersten erstinstanzlichen Verfahren am 17.11.2000 zu den Akten gegeben; wegen unvollständigem Aktenverzeichnist kann keine act.-Nr angegeben werden.) Einleitend schreibt Shahak:
Obwohl sich dieses Buch an Menschen wendet, die ausserhalb des Staates Israel leben, ist es gewissermassen eine Fortsetzung meiner politischen Aktivitäten als israelischer Jude. Diese Aktivitäten begannen in den Jahren 1965-1966 mit einem Protest, der seinerzeit einen beachtlichen Skandal verursachte: Ich war selbst Augenzeuge eines Vorfalls, bei dem ein ultrareligiöser Jude die Erlaubnis verweigerte, sein Telefon am Sabbat zu benutzen, um einen Rettungswagen für einen Nichtjuden herbeizurufen... Anstatt den Vorfall einfach in der Presse zu veröffentlichen, bat ich um ein Treffen mit den Mitgliedern des Rabbinischen Gerichtes von Jerusalem, das aus Rabbinern zusammengesetzt ist, die vom Staate Israel ernannt werden. Ich fragte sie, ob ein solches Verhalten mit ihrer Interpretation der jüdischen Religion vereinbar sei. Sie antworteten mir, dass sich der betreffende Jude richtig, ja sogar fromm verhalten habe... Weder die israelischen noch die in der Diaspora lebenden Autoritäten hoben ihre Vorschrift jemals auf, derzufolge ein Jude den Sabbat nicht entheiligen dürfe, um das Leben eines Nichtjuden zu retten. Sie fügten dem Sinne nach viel scheinheiliges, albernes Geschwätz hinzu...
Soweit ein erstes Zitat aus dem Buch von Shahak. Er beschreibt dann ausführlich die staatliche Diskriminierung der nichtjüdischen Bürger Israels, die selbst dann nicht die gleichen Rechte auf Arbeit und Landbesitz erlangen wie Juden, wenn sie für Israel Militärdienst leisten und hohe Stellungen in der Wirtschaft erreicht haben.
Es wäre ein Fehler zu glauben, diese Berichte von Shahak seien erfunden und die von mir oben zitierte Diskriminierung von Nichtjuden im Talmud seien heute bedeutungslos. Wenn alle Absurditäten aus dem jüdischen Glauben entfernt und der modernen Zeit angepasst worden wären, gäbe es auch das Schächten von Tieren nicht mehr!
Sicher leben nicht alle Juden nach dem Talmud, ja sogar mehrheitlich nicht. Diese sind aber von meiner Schächtkritik auch nicht betroffen.
Weiter aus dem Buch von Shahak:
Während des Bestehens des Tempels durfte der Hohepriester nur eine Jungfrau heiraten. Obwohl es im Grunde genommen während der gesamten talmudischen Periode keinen Tempel oder Hohepriester mehr gab, widmet der Talmud eine seiner besonders verworrenen und grotesken Erörterungen der genauen Bestimmung der Eigenschaften der 'Jungfrau', die geeignet ist, einen Hohepriester zu heiraten. Wie steht es mit einer Frau, deren Jungfernhäutchen durch einen Unglücksfall zerrissen worden ist? Macht es einen Unterschied, ob der Unfall vor oder nach dem Alter von drei Jahren stattfand? Durch das Einwirken von Metall oder Holz? Kletterte sie auf einen Baum? Und wenn ja, kletterte sie hinauf oder herunter? Alles dies und noch vieles mehr wird in langatmigen Einzelheiten erörtert.
Wie erwähnt, ist das talmudische System äusserst dogmatisch und erlaubt keinerlei Lockerung seiner Regeln, nicht einmal, wenn sie durch eine Veränderung der Umstände ad absurdum geführt werden. Und im Falle des Talmuds - im Gegensatz zu jenem der Bibel - ist der buchstäbliche Sinn des Textes bindend.
Das Melken am Sabbat ist in nachtalmudischen Zeiten verboten worden, und zwar durch den Prozess der Verschärfung der religiösen Strenge. Das Verbot konnte in der Diaspora leicht eingehalten werden, da Juden, die eigene Kühe besassen, gewöhnlich reich genug waren, um nichtjüdische Bedienstete zu haben, die mit dem Melken beauftragt werden konnten, wobei man eine der nachfolgend beschriebenen Ausflüchte benutzte. Die ersten jüdischen Siedler in Palästina beschäftigten Araber für diesen und andere Zwecke, doch mit der zwingenden Forderung der zionistischen Politiker nach ausschliesslich jüdischen Arbeitskräften gab es die Notwendigkeit einer Dispensation... Nach der Auffassung zionistischer Rabbiner ist das verbotene Melken unter der Voraussetzung erlaubt, dass die Milch nicht weiss ist, sondern blau gefärbt wird. Diese blaue Samstagsmilch wird dann ausschliesslich zur Käseherstellung verwendet und der Farbstoff in die Molke ausgewaschen. Nichtzionistische Rabbiner haben sich aber eine viel spitzfindigere Methode zur Lösung des Problems ausgedacht, deren persönlicher Zeuge ich war, als ich 1952 in einem religiösen Kibbuz arbeitete. Sie entdeckten eine alte Anweisung, die es erlaubt, die Euter einer Kuh am Sabbat zu leeren, nur um das Tier von seiner Pein zu befreien, die durch die aufgeblähten Euter verursacht wird, und unter der strengen Bedingung, dass die Milch ungenutzt auf den Boden fliesst. Nun der Ablauf, wie er wirklich stattfindet: Am Samstagmorgen geht ein frommer Kibbuznik in den Kuhstall und stellt Eimer unter die Kühe. Es gibt kein Verbot einer solchen Tätigkeit in der gesamten talmudischen Literatur. Dann geht er zur Synagoge, um zu beten. Dann erscheint sein Kollege, dessen Absicht es ist, die Tiere von ihrer Pein zu befreien, und lässt die Milch auf den Boden rinnen. Aber falls dort zufällig ein Eimer steht, ist er dann in jeder Hinsicht verpflichtet, diesen zu entfernen? Natürlich nicht. Er 'ignoriert' die Eimer einfach, erfüllt seine Mission der Barmherzigkeit und geht zur Synagoge. Schliesslich geht ein dritter frommer Kollege in den Kuhstall und entdeckt zu seiner grossen Überraschung die mit Milch gefüllten Eimer. Also stellt er sie in den Kühlraum und folgt seinen Kameraden in die Synagoge. Nun ist alles bestens, und es besteht keine Notwendigkeit, Geld für blaue Farbe zu verschwenden.
Ohne spezielle Dispensation besteht ein grosses Hindernis für die Beschäftigung von Nichtjuden, um Samstagarbeiten zu erledigen, denn die talmudischen Vorschriften verbieten es Juden, einen Nichtjuden darum zu bitten, am Sabbat irgendeine Arbeit zu verrichten, deren Ausübung ihnen selbst verboten ist. Ich werde zwei der vielen Arten von Dispensationen beschreiben, die für solche Zwecke gebraucht werden. Erstens gibt es die Methode des Andeutens, nach der ein sündhaftes Verlangen untadelig wird, wenn es schlau in Worte gefasst ist. Normalerweise muss die Andeutung 'unauffällig' sein, aber in Fällen äusserster Notwendigkeit ist eine 'durchsichtige' Andeutung erlaubt. So ist zum Beispiel kürzlich eine Broschüre über die Befolgung religiöser Vorschriften für israelische Soldaten herausgegeben worden, in der diese unterwiesen werden, wie sie die arabischen Arbeiter, die von der Armee als Sabbat-Gojim angestellt sind, anzusprechen haben [Gojim ist die jüdische Bezeichnung für Nichtjuden]. In dringenden Fällen, wenn es etwa sehr kalt ist und ein Feuer angezündet werden sollte, darf ein frommer jüdischer Soldat eine 'durchsichtige' Andeutung benutzen und dem Araber sagen: 'Es ist kalt hier.' Aber gewöhnlich muss eine 'unauffällige' Andeutung genügen, wie beispielsweise: 'Es würde angenehmer sein, wenn es hier wärmer wäre.'
Ein beherrschender Grundzug dieses Systems der Dispensation ist der Betrug, vor allem die Täuschung Gottes, falls dieses Wort für ein imaginäres Wesen benutzt werden darf, das sich so leicht von den Rabbinern betrügen lässt, die sich selbst für schlauer halten als Gott.
Aus ethischer Sicht stellt das klassische Judentum einen Entartungsprozess dar, der sich immer noch fortsetzt; und diese Ausartung in eine stammeseigene Sammlung leerer Rituale und magischen Aberglaubens hat sehr bedeutsame soziale und politische Folgen. Denn es muss daran erinnert werden, dass es genau der Aberglaube des klassischen Judentums ist, der die stärkste Macht auf die jüdischen Massen ausübt, viel mehr als jene Teile der Bibel oder sogar des Talmuds, die von wirklichem religiösem und ethischem Wert sind.
Das zweite beherrschende Merkmal der Dispensationen ist, dass sie zum grossen Teil offensichtlich in dem Streben nach Gewinn begründet sind. Und es ist diese Verbindung aus Heuchelei und Profitsucht, die im klassischen Judentum in steigendem Masse vorherrschte. In Israel, wo dieser Prozess weitergeht, wird dies von der öffentlichen Meinung dumpf wahrgenommen, trotz all der offiziellen Gehirnwäsche, die durch das Ausbildungssystem und die Medien begünstigt wird.
Wie die Vorinstanz dazu kommt, zu behaupten, im heutigen Judentum würde nicht mehr an Abartigem festgehalten ist schleierhaft. Diese Feststellung ist offensichtlich haltlos und willkürlich. Was dem BF als rassendiskriminierend vorgehalten wird, ist eine sachlich begründete Äusserung. Gemäss Praxis des BGE ist eine sachlich begründete Kritik an religiösen Gruppen erlaubt (BGE 6S.64/2004); die Verurteilung stellt eine diskriminierende Verletzung der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit dar (EMRK 14 iVm EMRK 10).
Der erste Teil der inkriminierten Textpassage lautet:
Nur eine ganz spezielle Volksgruppe ist immun vor solchen Verfolgungen - ausgerechnet eine Volksgruppe, welche in ihren Büchern die allerschlimmsten rassistischen Weltanschauungen verbreitet.
Der BF behauptet hier nicht, den zitierten Talmud-Lehren würde heute noch aktiv nachgelebt. Er stellt lediglich fest, dass diese heute noch verbreitet werden, was objektiv wahr ist.
Indem die Vorinstanz den inkriminierten Text umdeutet und dahingehend auslegt, die Juden würden diese talmudischen Lehren heute noch praktizieren, was der BF weder gesagt noch gemeint hat, hat sie sich über BGE X c. A hinweggesetzt, wonach "nich leichthin angenommen werden darf, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Für diese grundlose Missachtung einer konstanten Bundesgerichtspraxis hat die Vorinstanz keinerlei Begründung oder Rechtfertigung angegeben. Das stellt eine willkürliche, bundesrechtswidrige Anwendung von Bundesrecht dar.
Der zweite Teil der inkriminierten Textpassage lautet:
Authentische Zitate aus ihrem "Talmud" genannten Bekenntnis, in welchem man - wie damals in Hitlers "Mein Kampf" - ihre rassistischen Theorien ganz offen nachlesen kann...
Auch das ist eine sachlich begründete Feststellung, die objektiv wahr ist.
Die Vorinstanz wirft dem BF vor (Seite 56, 4.b), indem er diesen talmudischen Rassismus mit dem Rassismus Hitlers vergleiche, stelle er die Juden als verabscheuungswürdig und verbrecherisch dar. Nach der Begründung, warum nationalsozialistischer Rassismus verabscheuungswürdig und verbrecherisch sein soll, jüdischer aber nicht, sucht man vergebens (Verletzung der Begründungspflicht) und ist mit gesundem Menschenverstand und Logik unvereinbar und deshalb widersprüchlich und willkürlich. Eine solche Begründung wäre aber für eine Verurteilung zu Gefängnis - ein schwerwiegender Eingriff in die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - unentbehrlich, denn Grundrechtseingriffe bedürfen gemäss Praxis des EGMR zwingend einer Güterabwägung und des Nachweises der Notwendigkeit. Dies umso mehr, als nicht - wie die Vorinstanz offenbar annimmt - jede Zurücksetzung im vornherein rassendiskriminierend ist, sondern nur eine unberechtigte, was hier eben gerade nicht der Fall ist. Günter Stratenwerth ("Schweizerisches Strafrecht", Besonderer Teil II, fünfte Auflage, Seite 181):
... dass das Verbot der Diskriminierung, wie schon der Gleichheitssatz als solcher, immer nur auf die unberechtigte Zurücksetzung der betroffenen Person bezogen werden kann.
Eine objektiv-sachlich zutreffende Feststellung ist keine "unberechtigte Zurücksetzung". Umso mehr stellt das Fehlen einer substanziellen Begründung im vorinstanzlichen Urteil einen gravierenden Mangel dar. Die Oberflächlichkeit, mit dem der BF auch in diesem Punkt wieder zu Gefängnis verurteilt wurde, ist eines Rechtsstaates unwürdig und wird vom EGMR sicher nicht als genügende Begründung für die Notwendigkeit eines schweren Grundrechtseingriffs akzeptiert werden. Dem BF wird durch diese ungenügende, oberflächliche Scheinbegründung verunmöglicht, sich im Sinne einer wirksamen Verteidigung gezielt mit den Beweggründen der Vorinstanz auseinanderzusetzen. Während es an anderer Stelle noch möglich war, gewisse Mutmassungen über die nicht offen gelegten Erwägungen der Vorinstanz anzustellen, besteht hier nicht einmal diese Möglichkeit. Wenn das Gericht einfach vom politischen Axiom ausgeht, vergleichbarer Rassismus dürfe nur bei den Nazis als verabscheuungswürdig bezeichnet werden, nicht aber bei fanatisch-fundamentalistischen Juden, dann ist einer vernünftigen und wirksamen Verteidigung der Boden entzogen. Es bleibt nur Kopfschütteln, was nicht als wirksame Verteidigung angesehen werden kann. Was mögliche rationale Gründe sein könnten für das vorinstanzliche Urteil, übersteigt in diesem Punkt, wegen dem der BF zu Gefängnis unbedingt verurteilt wurde, die Fantasie des BF wie auch seiner Verteidiger. Damit sind auch hier die Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 schwerwiegend verletzt worden .
Der dritte und letzte Teil des inkriminierten Textes lautet:
Und wie die heute von den Juden solidarisch verteidigte grausame Schächt-Tradition zeigt, wird an abartigen Vorstellungen aus uralten jüdischen Traditionen auch heute noch zäh festgehalten.
Nach Auffassung der Vorinstanz (Seite 57) ist es offenbar unzulässig, das Schächten als Abartigkeit zu bezeichnen. Eine solche subjektive und selber abartige Auffassung, die klar der Faktenlage und der allgemein vorherrschenden öffentlichen Meinung zuwiderläuft, rechtfertigt niemals einen schweren Eingriff (Gefängnis unbedingt) in die durch die EMRK garantierten Grundrechte (Meinungs- und Medienfreiheit). Hier wurde ganz offensichtlich EMRK 10 verletzt.
Zu Ziffer VI der Anklageschrift vom 8. August 2000:
Die Veröffentlichung www.vgt.ch/news_bis2001/980615.htm, in welcher kritisch über die Verurteilung im sog ersten Schächtprozess berichtet wurde, hat das Obergericht als rassendiskriminierend beurteilt (Seite 58), weil der BF die fragliche Äusserung mit folgndem Satz erneut bekräftigt habe:
In diesem verluderten Staat ist es bei Gefängnisstrafe verboten, treffende Fragen zu stellen! Die gruppen-egoistische Schein-Toleranz von Ruth Dreifuss lässt sich nicht treffender formulieren, als mit dieser Frage, auf welche Dreifuss bis heute keine Antwort weiss.
Demgegenüber sprach das Obergericht den BF bezüglich einer anderen kritischen Kommentierung seiner Verurteilung (www.vgt.ch/vn/9806/vn98-6.htm#Geflügel-Schächten; Ziffer V. der Anklageschrift) frei (Urteil vom 29. Dezember 2004, Seite 58), wo der Ang schrieb:
Auch meine Überzeugung, dass Schächt-Juden charakterlich nicht besser sind als ihre früheren Nazihenker, wurde als rassendiskriminierend beurteilt.
Im einen wie im anderen Fall hat der BF über seine Verurteilung wegen Äusserungen zum Schächten berichtet und die Verurteilung als ungerecht kritisiert. In beiden Fällen geht aus der Kritik hervor, dass der BF seine Ansichten nicht geändert habe und weiter daran festhalte - im ersten Fall mit den Worten, es gäbe keine treffendere Formulierung, im zweiten Fall damit, dies sei seine Überzeugung.
Die Verurteilung im ersten Fall und der Freispruch im zweiten Fall ist widersprüchlich. Entweder ist die erneute Bekräftigung einer inkriminierten Äusserung im Rahmen einer justizkritischen Veröffentlichung verboten, dann hätte in beiden Fällen ein Schuldspruch erfolgen müssen, oder Justizkritik ist grundsätzlich erlaubt, dann hätte in beiden Fällen ein Freispruch erfolgen müssen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich aus der materiellen Kritik eines Urteils ableiten lässt, der Autor halte die Tat für rechtmässig. Dies muss im Rahmen der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - welche Justizkritik einschliesst - erlaubt sein. Jede gegenteilige Auffassung und so auch die Argumentation des Obergerichtes in casu, verhindert Justizkritik, was mit den Garantien der EMRK unvereinbar ist.
Das vorinstanzliche Urteil ist in diesem Punkt widersprüchlich, diskriminierend (EMRK 14 iVm EMRK 10) und stellt einen in einer demokratischen Gesellschaft nicht nötig und unverhältnismässigen Eingriff in EMRK 10 dar. Art 261bis StGB ist nicht EMRK-konform ausgelegt worden.
Diskriminierend im Sinne von EMRK 14 iVm EMRK 10 ist das vorinstanzliche Urteil in diesem Punkt, weil es ohne sachliche Rechtfertigung die Meinungsäusserungsfreiheit in analogen Fällen einmal als strafbar und ein andermal als erlaubt beurteilt. Damit wird die menschenrechtswidrige Unbestimmtheit von StGB 261bis noch verstärkt anstatt schärfer umrissen. Der Angeklagte weiss auch künftig nicht, was nun erlaubt ist und was nicht. Dahinter steht vermutlich die politische Absicht, den unbequemen Angeklagten durch eine solche Rechtsprechung mit immer höheren Gefängnisstrafen derart zu verunsichern, dass er aus blosser Vorsicht und Selbstschutz künftig kaum mehr etwas zu sagen wagt (verpönter chilling-effect).
Festzuhalten ist, dass die Vorinstanz zu Recht auch Justizkritik in eigener Sache als grundsätzlich erlaubt beurteilt (Seite 57).
Von einer reinen Wiederholung unerlaubter Äusserungen unterscheidet sich Justizkritik entscheidend darin, dass der Leser einer Justizkritik erfährt, dass die fragliche Äusserung rechtskräftig als unerlaubt beurteilt worden ist. Dieser Unterschied rechtfertigt es nicht, Justizkritik wie unerlaubte blosse Wiederholungen als strafbar zu beurteilen. Hiefür besteht jedenfalls im Sinne der EGMR-Praxis keine Notwendigkeit in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, weshalb das vorinstanzliche Urteil einen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht gemäss EMRK 10 darstellt.
Zu Ziffer VII der Anklageschrift vom 8. August 2000
Der deutsche Dichter Manfred Kyber lebte von 1880-1933. Von seinen zahlreichen Tierbüchern (Beilage 9) sind einige nach wie vor beliebt und im Buchhandel erhältlich (im erstinstanzlichen Verfahren zu den Akten gegeben):





In den VgT-Nachrichten vom November 1998 wurde auf Seite 15 kommentarlos (sic!) ein seitenfüllender Auszug aus obigem Buch "Tierschutz und Kultur" des deutschen Schriftstellers Manfred Kyber (1880-1933) veröffentlicht. Die vom BF (Erwin Kessler) - Redaktor der VgT-Nachrichten - gesetzte Titel lautete:
Schächten
aus dem Buch "Tierschutz und Kultur von Manfred Kyber,
deutscher Schriftsteller, 1880-1933
Hierauf folgte ein zusammenhängender, wörtlicher Buch-Auszug ohne wesentliche Auslassungen.
Der BF hat in seinem im ersten erstinstanzlichen Verfahren eingereichten Plädoyer vom 7. November 2001 zum vorliegenden Anklagepunkt betr den Auszug aus dem Buch von Manfred Kyber Stellung genommen (Seite 53 - 56). Die Vorinstanz hat das offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen und jedenfalls mit keinem Wort gewürdigt (Verletzung des rechtlichen Gehörs). Das ist umso unverständlicher, als der BF dort auf einen rechtskräftigen Entscheid hingewiesen hat, wonach der inkriminierte Buchauszug eindeutig nicht rassendiskriminierend ist:
Nichtanhandnahmeverfügung der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 2.10.2000 bezüglich dem Buch "Tierschutz und Kultur" von Manfred Kyber. Bei dieser Nichtanhandnahmeverfügung ging es genau um den in casu inkriminierten Buchauszug. Die Nichtanhandnahme wurde wie folgt begründet (Beilage 9 zum Plädoyer vom 7. November 2002, hier nochmals beigelegt):
Aus diesem Text ist nun nicht ersichtlich, dass mit der Verbreitung des Buches gegen Art 271bis [recte: 261bis] StGB verstossen wird.
Die Nichtbeachtung dieser rechtskräftigen Verfügung durch die Vorinstanz stellt eine massive Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Indem die Vorinstanz den BF zu Gefängnis unbedingt verurteilt hat wegen einem angeblich rassendiskriminierenden Text, der in einem früheren rechtskräftigen Entscheid als völlig klar nicht tatbestandsmässig beurteilt worden ist, stellt absolute Willkür dar und eine diskriminierende Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit (EMRK 14 iVm EMRK 10).
Die Vorinstanzen sind mit dem Plädoyer des BF vom 7. November 2001 willkürlich umgesprungen. Zuerst wurde es rechts- und menschenrechtswidrig aus dem Recht gewiesen (Ziffer 1.1), dann wurde es - ohne diesen Beschluss aufzuheben - doch verwendet, um den BF zu belasten (Ziffer 1.4). Im vorliegenden Punkt betreffend Manfred Kyber wurde es wiederum völlig nicht beachtet. Das ist Rechtswillkür in Reinkultur! (Der EGMR prüft auch Willkür, wenn diese im Zusammenhang mit einer Grundrechtsverletzung steht.)
Die frei im Buchhandel und in schweizerischen Bibliotheken erhältliche, im "bioverlag gesundleben" erschienene Ausgabe von Kybers Buch enthält folgendes Vorwort des Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, Dr A Grasmüller:
Dieses Buch müsste jedem, nicht nur dem Tier- oder Naturschützer, zur Pflichtlektüre übergeben werden. ... weil sein Inhalt diejenigen aufrüttelt, die heute für diese Grundgedanken menschlicher Lebensnotwendigkeit immer noch kein Verständnis aufbringen. Es wird die Zeit kommen, wo man Politiker, Industrielle und Mitmenschen zur Verantwortung ziehen muss, weil sie in vergangenen Jahren der Tierwelt gegenüber gewissenlos gehandelt haben. Ob diese Verantwortlichen dann noch leben bleibt dahingestellt. Mir selbst ist es aber ein Trost zu wissen, dass sie nach ihrem Tode mit Sicherheit dafür an anderer Stelle zur Verantwortung gezogen werden.

Der Deutsche Tierschutzbund, der dies schreibt, ist nicht irgend ein unbedeutender Tierschutzverein, sondern die grösste und massgeblichste Tierschutzorganisation Deutschlands.
Wer heute aus den Werken deutscher Literatur zitiert, wird in der Schweiz ins Gefängnis geworfen! Die absehbare erneute Verurteilung der Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird wieder einigen Bürgern mehr die Augen öffnen.
Zu V. 7 des vorinstanzlichen Urteils:
Seite 59 oben behauptet die Vorinstanz (Obergericht) zusammenfassend zu den Ziff. II, III, VI und VII der Anklage vom 8. August 2000:
Die Juden werden, weil sie an diesem Ritual als Teil ihrer Religion - im Rahmen des Erlaubten - festhalten, als Unmenschen bezeichnet, mit Nazihenkern und Menschenfressern verglichen und als abartig, charakterlich minderwertig und verabscheuungswürdig dargestellt.
Dies stellt eine haltlose, aktenwidrige und willkürliche Beweiswürdigung dar, weil der BF in allen diesen Veröffentlichungen
a) nirgends "die Juden" insgesamt, sondern stets differenziert nur die unbestimmte Minderheit der Schächtjuden mit Nazis verglichen und ihnen unmenschliches Verhalten vorgeworfen hat,
b) weder die Juden allgemein noch die Schächtjuden mit Menschenfressern verglichen hat, sondern lediglich Bundesrätin Dreifuss gefragt hat, ob sie gegenüber Menschenfressern auch so tolerant wäre,
c) "die Juden" nirgends als abartig und verabscheuungswürdig dargestellt, sondern lediglich festgestellt hat, dass an abartigen Vorstellungen aus uralten jüdischen Traditionen festgehalten werde.
Zu a):
Indem die Vorinstanz ohne jede Begründung und damit willkürlich behauptet, der inkriminierte Text beziehe sich auf "die Juden", dh allgemein auf alle Juden, hat sie sich über die Praxis des Bundesgerichtes (BGE X c. A) hinweggesetzt, wonach "nich leichthin angenommen werden darf, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Für diese grundlose Missachtung der Bundesgerichtspraxis hat die Vorinstanz keinerlei Begründung oder Rechtfertigung angegeben. Es liegt eine falsche Anwendung von Bundesrecht vor.
Zu b):
Die jüdische Bundesrätin Dreifuss sprach sich gegen das Schächtverbot aus und begründete dies wie folgt:
Für mich ist dies eine Frage der Glaubens- und Gesinnungsfreiheit. Wer sich davon distanziert, masst sich Kritik an religiösen Werten an, die gewissen Menschen wichtig sind. Das möchte ich nicht.
Hierauf fragte der BF Frau Dreifuss, ob sie gegenüber Menschenfressern auch so tolerant wäre, insbesondere wenn Juden betroffen wären. Daran anschliessend folgte die weitere Frage:
Und was meinen Sie zum Todesurteil gegen Salman Rushdi? Wollen Sie sich da auch keine Kritik an religiösen Werten anmassen? Oder gilt Ihre religiöse Toleranz vielleicht nur gegen Juden, nicht gegen Andersgläubige?
Es ist offensichtlich und für den Leser des gesamten Textes ohne weiteres verständlich, dass der BF mit diesen rhetorischen Fragen aufzeigen wollte, wohin eine blinde, bedingungslose Toleranz gegenüber allem, was von den Tätern als "religiös" behauptet wird, führen kann. Die Umdeutung der Vorinstanz, damit habe der BF "die Juden" Menschenfressern gleichgestellt, ist absurd, haltlos und willkürlich - allein schon deshalb, weil bekanntlich ein Vergleich keine Gleichsetzung ist. Ein Vergleich dient dazu, jemandem anhand eines leichter verständlichen Beispieles etwas anderes verständlich zu machen, das er auf direktem Weg nicht begreift. Als Jüdin ist Frau Bundesrätin Dreifuss offensichtlich total blind, das Verbrecherische und Unmenschliche am jüdischen Schächten zu erkennen. Der BF ging davon aus, dass sie gegenüber anderen Unmenschlichkeit im Namen einer Religion weniger blind sei und damit erkennen könne, wohin Toleranz gegenüber religiösen Perversionen führen kann. Wenn das in der Schweiz im Rahmen einer nationalen Debatte von grossem öffentlichen Interesse nicht mehr erlaubt ist, dann gute Nacht Schweiz. Mit einer erneuten Verurteilung der Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist zu rechnen.
Indem die Vorinstanz ohne jede Begründung willkürlich behauptet, der BF habe die Juden Menschenfressern gleichgestellt, hat sie sich über die Praxis des Bundesgerichtes (BGE X c. A) hinweggesetzt, wonach "nich leichthin angenommen werden darf, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Für diese grundlose Missachtung der Bundesgerichtspraxis hat die Vorinstanz keinerlei Begründung oder Rechtfertigung angegeben. Es liegt eine falsche Anwendung von Bundesrecht vor.
zu c):
Die Vorinstanz deutet die Feststellung des BF(Erwin Kessler), die Juden würden an abartigen Vorstellungen aus uralten jüdischen Traditionen festhalten, willkürlich dahingehend um, der BF habe die Juden selber als abartig dargestellt, was unzulässig ist.
An gleicher Stelle behauptet die Vorinstanz weiter, der BF habe "die Juden" kritisiert, "weil sie an diesem Ritual als Teil ihrer Religion festhalten". Diese urteilsentscheidende Feststellung der Vorinstanz ist völlig unwahr und willkür. Das Schächten ist eben gerade kein Ritual, keine Kultushandlung (siehe Ziffer 4.3.5), vielmehr wird es Metzgern überlassen, die beim Schächten grinsen und Zigaretten rauchen (siehe Ziffer 4.9.2). Das Schächten ist lediglich eine besondere Art der Fleischgewinnung. Die Vorinstanz hat ihre gegenteilige, von der vorherrschenden Auffassung abweichende Behauptung mit keinem Wort begründet (Verletzung der Begründungspflicht). Der vorinstanzliche Eingriff in das menschenrechtlich garantierte Grundrecht der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit beruht damit auf einer haltlosen, unbegründete Tatsachenbehauptungen (Willkür, Verletzung von EMRK 10).
Indem die Vorinstanz die Verurteilung nicht darauf stützt, was der BF wirklich geäussert hat, sondern auf willkürliche, unbegründete Umdeutungen, hat sie sich einmal mehr über die Praxis des Bundesgerichtes (BGE X c. A) hinweggesetzt, wonach "nich leichthin angenommen werden darf, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Für diese grundlose Missachtung der Bundesgerichtspraxis hat die Vorinstanz keinerlei Begründung oder Rechtfertigung angegeben. Es liegt eine falsche Anwendung von Bundesrecht vor.
4.9.2 Anklageschrift vom 28. April 2003
Unter VII/1b behauptet die Vorinstanz, "der Vorwurf, dass der Angeklagte mit der fraglichen Veröffentlichung Äusserungen wiederholt habe, für die er schon früher verurteilt worden sei, hätte gar nicht in die Anklageschrift aufgenommen werden dürfen (§162 Abs 2 StPO; Erw. II/5g)". Diese Feststellung erst in der zweitinstanzlichen Urteilsbegründung beseitigt diesen Mangel der Anklageschrift und die dadurch erfolgte Behinderung und Irreführung der Verteidigung (Verletzung von EMRK Art. 6 Ziff. 3a, wonach ein Angeklagter in einem frühen Verfahrensstadium "...in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Kenntnis gesetzt wird"). Die Anklageschrift hätte schon von der ersten Instanz, dem Antrag der Verteidigung folgend, zur Berichtigung an die Anklagebehörde zurückgewiesen werden müssen. Zumindest hätte das Gericht selber für die nötigen Präzisierungen sorgen müssen. Indem beides unterlassen wurde, wurden die Verteidigungsrechte in menschenrechtswidriger Weise verletzt. Zudem ist in den Erw. II/5g, auf die verwiesen wird, gar nichts darüber zu finden; die Begründungspflicht wurde deshalb auch in diesem Punkt verletzt.
Zu lit a der Anklage vom 28. April 2003:
Hier geht es um den Vorwurf "jüdischer Lügen" zum Schächten, der auf zwei Seiten in den VgT-Nachrichten VN02-2 vom Mai 2002 auftaucht und der dem BF in der Anklageschrift als rassendiskriminierend vorgeworfen wird.
Die erste der inkriminierten Veröffentlichungen (im Internet veröffentlicht unter www.vgt.ch/media/Standbilder-schaechten/index.htm#Positionspapier) trägt die Überschrift
"Jüdische Lügen zum Schächten"
und den Untertitel:
"Kommentar von Erwin Kessler, Präsident VgT, zu einem 'Positionspapier' des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes vom Oktober 2001"
Einleitend wird im ersten Abschnitt das Thema der Veröffentlichung umrissen:
In diesem 'Positionspapier' werden die üblichen jüdischen Lügen zum Schächten wiederholt... das Schächten sei keine Tierquälerei. ...
Im zweiten Abschnitt wird auf eine weitere Lüge zum Schächten hingewiesen:
Neben der Lüge, Schächten sei keine Tierquälerei, wird im "Positionspapier" weiter gelogen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe in einem Urteil vom 27. Juni 2000 festgestellt, das Schächten sei durch die Religionsfreiheit geschützt. In Wahrheit hat der Gerichtshof diese Frage gar nicht beurteilt...
Im dritten Abschnitt wird eine dritte Lüge zum Schächten erwähnt:
Weiter enthält das Positionspapier auch die jüdische Standardlüge, das Schächtverbot habe seit über hundert Jahren mehr antisemitische als tierschützerische Motive. Wahr daran ist nur, dass man angesichts der widerlichen Verlogenheit der organisierten Juden zum Thema Schächten als Tierschützer eine fast übermenschliche Charakterstärke haben muss, um nicht tatsächlich judenfeindlich zu werden. Um mich vor rassistischen Verallgemeinerungen zu schützen - mein tierschützerischer Kampf hat sich bisher stets gegen die Schächtjuden, nicht gegen die Juden insgesamt gerichtet - denke ich, wenn mich jüdisches Verhalten wieder einmal anwidert, an den grossen, leider verstorbenen jüdischen Musiker Yehudi Menuhin, den ich sehr schätze und achte. Er war Schächtgegner und Vegetarier wie ich.
Damit hat sich der BF ausdrücklich von rassistischen Verallgemeinerung der jüdischen Verlogenheit zum Schächten distanziert, was von der Vorinstanz willkürlich völlig unbeachtet geblieben ist (Verletzung des rechtlichen Gehörs, willkürliche Beweiswürdigung).
Im vierten Abschnitt werden die vorerwähnten Lügen zum Schächten als jüdische Stereotypien bezeichnet:
Neben diesen jüdischen Stereotypien enthält das Positionspapier auch interessante Neuigkeiten: Weil das angebliche Betäubungsverbot beim Schlachten von Tieren weder in der Thora noch im Talmud zu finden ist, behauptet der Schweizerische Israelitische Gemeindebund nun einfach, das Schächtverbot sei "von Gott selber vorgeschrieben".
Der fünfte Abschnitt kommentiert die Gründe, aus denen die Schächtjuden nach Auffassung des BF am Schächten festhalten. Von Lügen ist darin nicht mehr die Rede.
Nirgends wird hier den Juden allgemein, den Schächtjuden oder sonst irgendwelchen Juden Verlogenheit anders als im Zusammenhang mit den in den Abschnitten 1 bis 3 konkretisierten Lügen zum Schächten vorgeworfen. Die gegenteilige Auslegung durch die Vorinstanz (Seite 68) ist krass unwahr (willkürliche Beweiswürdigung).
Gemäss konstanter Bundesgerichtspraxis (siehe zB BGE X c. A) ist der Sinn einer Äusserung im Gesamtzusammenhang zu beurteilen. Dies hat die Vorinstanz unterlassen. Die Vorinstanz stützt ihre Behauptung, der BF bezichtige die Juden ganz allgemein der Lügenhaftigkeit, ausdrücklich auf einen isolierten Satz, ohne Beachtung des oben erwähnten Gesamtzusammenhanges. Damit hat die Vorinstanz willkürlich die vom Bundesgericht vorgegebenen Grundsätze für Äusserungsdelikte missachtet und dadurch die Rassendiskriminierungsstrafnorm bundesrechtswidrig angewendet.
Das schamlose Ableugnen des Leidens der Tiere beim Schächten ohne Betäubung durch jüdische Kreise geht aktuell weiter, wie der Brief von Alfred Donatsch, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes vom 21.2.2005 (Beilage 10) belegt. Donatsch ist Arzt und muss wissen, dass er lügt. Diese schamlose Verlogenheit anzuprangern, muss in einem Vertragsstaat der EMRK verlaubt sein!
Die Anklageschrift verweist unter lit a sodann auch noch auf Seite 18 der gleichen Ausgabe der VgT-Nachrichten, die ebenfalls vollständig - mit mehreren Kurzbeiträgen - dem Schächten gewidmet ist. Die Kurzbeiträge auf dieser Seite tragen die Überschriften
- "Der bekanntlich durch jüdische Kreise leicht erpressbare Bundesrat will das Schächtverbot für Säugetiere aufheben"
- "Moslemisches Schächten"
- "Die von der jüdischen Bundesrätin Dreifuss eingesetzte 'Kommission gegen Rassismus' "
- "Frage an die Schächtjuden"
Der dritte dieser Kurzbeiträge hat folgenden Wortlaut (www.vgt.ch/vn/0202/landesregierung.htm#Kommission):
Die von der jüdischen Bundesrätin Dreifuss eingesetzte "Kommission gegen Rassismus" ist in Wirklichkeit ein mit Steuergeldern finanziertes Instrument zur Verbreitung jüdischer Propaganda: Die Kommission befürwortet die Aufhebung des Schächtverbots mit der klassischen jüdischen Lüge [im Original nicht hervorgehoben],eHer das Schächten sei für die Tiere nicht schlimmer als das sonst übliche Schlachten mit Betäubung.
Auch hier bezieht "die klassische jüdische Lüge" direkt und unzweifelhaft auf das Schächten. Als "klassisch" wurde diese Lüge bezeichnet, weil sie in der jüdischen Literatur zum Schächten seit Jahrzehnten systematisch wiederholt wird.
Die Vorinstanz hält zu diesen Veröffentlichungen fest (Seite 68):
Der blosse Hinweis, dass jemand, der gelogen habe, Jude sei, ist zwar tendenziell verletzend und jedenfalls unsachlich, weil damit insinuiert wird, dass diese beiden Fakten irgendwie miteinander zusammenhängen würden.
Die Behauptung der Vorinstanz ist willkürlich, denn zwischen dem Ableugnen der Schmerzhaftigkeit des Schächtens und der Tatsache, dass dieses Ableugnen durch Juden erfolgt, besteht ein direkter und wichtiger sachlicher Zusammenhang. Es ist für den Leser wichtig zu wissen, ob jemand, der sich so zum Schächten äussert, eine unabhängige Person ist oder ein Jude, der mit solchen Behauptungen egoistisch jüdische Interessen verfolgt.
Der BF hat nicht - wie die Vorinstanz willkürlich unterstellt - "bloss", dh ohne jede Begründung, einen Zusammenhang zwischen Lügen und Juden hergestellt.
In den inkriminierten Veröffentlichungen (Seite 18 und 20 der VgT-Nachrichten vom Mai 2002) geht es ganz klar und ausschliesslich um jüdische Lügen zum Thema Schächten. Da es nachweislich jüdische Kreise sind (siehe das in der inkriminierten Veröffentlichung erwähnte 'Positionspapier' zum Schächten des Israelitischen Gemeindebundes), welche diese Lügen in jüdischem Interesse verbreiten in der offensichtlichen Absicht, das jüdische Schächten zu verharmlosen und dessen Akzeptanz in der nichtjüdischen Bevölkerung zu erhöhen, besteht ein direkter sachlicher Zusammenhang zwischen dem Lügen und der Tatsache, dass es jüdische Kreise sind, die diese Lüge verbreiten. Der Vorwurf der Vorinstanz (Seite 6), der BF habe in unsachlicher Weise einen Zusammenhang zwischen Juden und Lügen hergestellt, ist darum aktenwidrig bzw eine willkürliche Beweiswürdigung dar.
Die Vorinstanz räumt ein, dass der Vorwurf jüdischen Leugnens in Bezug auf das Schächten nicht rassendiskriminierend sei (Seite 68). Willkürlich nicht beachtet hat sie jedoch, dass der Lügen-Vorwurf nirgends auf etwas anderes bezogen ist als auf das Schächten und dass dies für den Leser im Gesamtzusammenhang klar ist. Diese ganze Ausgabe der Zeitschrift ist dem Schwerpunktthema Schächten gewidmet. Auch in den einzelnen inkriminierten Artikel geht es unübersehbar deutlich einzig um das Schächten.
Die Vorinstanz hat auch willkürlich unbeachtet gelassen, dass diese Veröffentlichungen zum Schächten einen Beitrag zu einer damals landesweit geführten öffentlichen Diskussion über die vom Bundesrat geplante Abschaffung des Schächtverbotes darstellen. Äusserungen im Rahmen einer öffentlichen politischen Kontroverse sind durch die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit geschützt (siehe die in Abschnitt 4.1 angegebenen Quellen zu Lehre und Praxis des EGMR).
In der inkriminierten Veröffentlichung geht es ausschliesslich um das Schächten. In keinem anderen Zusammenhang wurde Juden Lügenhaftigkeit vorgeworfen.
Die Vorinstanz behauptet (Seite 68) mit der Formulierung "klassische jüdische Lüge" und "widerliche Verlogenheit der organisierten Juden" habe der BF unterstellt, die Juden seien aufgrund ihrer Religion und/oder Ethnie ganz allgemein lügnerisch veranlagt. Dies ist eine reine Erfindung der Vorinstanz, ohne jede objektive Grundlage in der inkriminierten Veröffentlichung, und steht im Widerspruch zum klaren, gegenteiligen Wortlaut (Aktenwidrigkeit, willkürliche Beweiswürdigung), wo es ausschliesslich um das Schächten geht.
Die Vorinstanz gibt zu diesem urteilsentscheidenden Vorhalt keinerlei Begründung. Der BF weiss deshalb nicht, wie die Vorinstanz zu dieser absurden Beurteilung kommt und kann sich deshalb nicht gezielt dagegen verteidigen (Verletzung der Begründungspflicht und der Verteidigungsrechte). Statt dessen hat die Vorinstanz diese Wörter in geradezu bösartiger Weise durch willkürliche Entkontextualisierung verdreht und ihnen eine Bedeutung zugeschrieben, die sie im Textzusammenhang offensichtlich nicht haben.
Willkürlich nicht beachtet hat die Vorinstanz auch, dass diese ganze Ausgabe der VgT-Nachrichten vom Mai 2002 schwerpunktmässig dem Thema Schächten gewidmet ist. Dieser Ausgabe war ein Unterschriftenbogen für die damals hängige eidg Volksinitiative gegen das Schächten beigefügt (siehe den roten Hinweis unten auf der Frontseite). Gemäss Praxis des EGMR wiegt die Einschränkung der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit im Zusammenhang mit einer öffentlichen Diskussion über ein die Gesellschaft bewegendes Thema besonders schwer und ist nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig, insbesondere im Interesse von Ruhe und Ordnung. Von einer solchen Notwendigkeit für einen Grundrechtseingriff kann in casu nicht die Rede sein.
Zusammenfassung:
Die Vorinstanz stützt die Verurteilung einzig und allein auf die beiden Formulierungen "klassische jüdische Lüge" und "widerliche Verlogenheit der organisierten Juden" ab mit der Begründung, damit werde den Juden allgemein Verlogenheit vorgeworfen. Indem sich diese Formulierungen jedoch - wie oben dargelegt - ganz direkt und unmittelbar, ausdrücklich und unmissverständlich auf das Thema Schächten beziehen, ist die vorinstanzliche Begründung aktenwidrig oder zumindest eine krass falsche, willkürliche Beweiswürdigung. Unbeachtet blieb der wichtige Umstand, dass das ganze Heft, in welchem die beiden inkriminierten Veröffentlichungen enthalten sind, schwerpunktmässig dem Thema Schächten gewidmet war, im Zusammenhang mit einer hängigen Volkinitiative gegen das Schächten stand und das Thema damals von grossem öffentlichen Interesse war, weil sich der Bundesrat gerade daran machte, das Schächtverbot aufzuheben, was einen landesweiten Sturm der Entrüstung auslöste (willkürliche Beweiswürdigung, Verletzung der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit).
Dadurch, dass der BF den Schächtjuden sachlich begründet Verlogenheit vorwirft, weil sie die Schmerzhaftigkeit des betäubungslosen Schächtens systematisch in Abrede stellen, hat der BF die Schächtjuden nicht wegen einer unabänderlichen, durch ihre Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Rasse oder Religion begründete Eigenschaft herabgesetzt. Es ist deshalb weder der objektive noch der subjektive Tatbestand erfüllt. (Nach Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3. Auflage, Seite 219, ist für den subjektiven Tatbestand der Wille des Täters erforderlich, "mit seinem Verhalten jemanden oder eine Personenmehrheit unter Berufung auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, Rasse oder Religion herabzusetzen...".)
Die Verurteilung verletzt die Meinungsäusserungsfreiheit in diskriminierender Weise (EMRK Art 14 iVm Artikel 10), indem die Vorinstanz andere, strengere Massstäbe angelegt hat als das Bundesgericht im Fall des Bieler Polizeidirektors Jürg Scherrer, wo das Bundesgericht nach folgenden Grundsätzen zu einem Freispruch gekommen ist (wörtliche Zitate aus BGE 6S.64/2004):
2.1 Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Strafbarkeit von Äusserungen
nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadressat diesen unter den
jeweiligen konkreten Umständen gibt.Handelt es sich um einen Text, so ist
dieser nicht allein anhand der verwendeten Ausdrücke - je für sich allein
genommen - zu würdigen, sondern auch nach dem Sinn, der sich aus dem Text als Ganzes ergibt.. Äusserungen, die im Rahmen politischer Debatten getätigt werden, sind nicht immer strikte an ihrem Wortlaut zu messen,da bei solchen Auseinandersetzungen oft gewisse Vereinfachungen und Übertreibungen üblich sind...
3.1 Bei der Auslegung von Art. 261bis StGB ist der Freiheit der
Meinungsäusserung (Art. 16 BV; Art. 10 EMRK; Art. 19 UNO-Pakt II) Rechnung zu tragen ... Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte Äusserungen zu politischen Fragen und Problemen des
öffentlichen Lebens ein besonderer Stellenwert zukommt. In einer Demokratie
ist es von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden
können, die einer Mehrheit missfallen und für viele schockierend wirken ... Kritik muss dabei in einer gewissen Breite und bisweilen auch in
überspitzter Form zulässig sein. Denn in öffentlichen Debatten ist es oft
nicht von Anfang an möglich, eindeutig zwischen unwahrer, halbwahrer und
begründeter Kritik zu unterscheiden. Werden durch eine extensive Auslegung
der Normen des Strafrechts zu hohe Anforderungen an kritische Äusserungen
gestellt, besteht die Gefahr, dass auch begründete Kritik nicht mehr
vorgebracht wird (Müller, a.a.O., S. 209 f. mit dem Hinweis auf den "chilling effect" [Abschreckungswirkung] einer zu strengen Beurteilung geäusserter Meinungen... Der Meinungsäusserungsfreiheit darf zwar
keine so weitreichende Bedeutung gegeben werden, dass das Anliegen der
Bekämpfung der Rassendiskriminierung seiner Substanz beraubt... Umgekehrt muss es in einer Demokratie aber möglich sein,auch am Verhalten einzelner Bevölkerungsgruppen Kritik zu üben. Eine Herabsetzung oder Diskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 4 StGB ist daher in der politischen Auseinandersetzung nicht leichthin zu bejahen. Jedenfalls erfüllt den Tatbestand nicht bereits, wer über eine von dieser Norm geschützte Gruppe etwas Unvorteilhaftes äussert, solange die Kritik insgesamt sachlich bleibt und sich auf objektive Gründe stützt... Äusserungen im Rahmen der politischen Auseinandersetzung sind dabei nicht zu engherzig auszulegen, sondern immer in ihrem Gesamtzusammenhang zu würdigen...
In der Literatur wird denn auch anerkannt, dass in der Berichterstattung über den Anteil einer Bevölkerungsgruppe an der Kriminalität, ja über deren besondere Neigung zu Straftaten keine gegen die Menschenwürde verstossende Herabsetzung liege, selbst wenn dadurch für deren Angehörige ein feindseliges Klima geschaffen werde... Anders zu beurteilen sind in der Regel Pauschalurteile, die sich nicht auf sachliche Gründe stützen lassen...
3.4.2 ...Trotzdem erscheint die inkriminierte Medienmitteilung im
Gesamtzusammenhang nicht unsachlich, zumal im politischen Meinungskampf
gewisse Vereinfachungen üblich sind (vgl. E. 3.1)...
Wird berücksichtigt, dass in der demokratischen Auseinandersetzung auch
politische Entscheide, die sich auf einzelne Bevölkerungsgruppen beziehen, in einer gewissen Breite kritisiert werden dürfen, erscheintdie fragliche
Medienmitteilung nicht als Herabsetzung oder Diskriminierung im Sinne von
Art. 261bis Abs. 4 StGB. Denn sie greift die Bevölkerungsgruppe der
Kosovo-Albaner über den konkreten Entscheid hinaus als solche nicht an und
stellt sie nicht als minderwertig hin.
Diese vom Bundesgericht in einem präjudiziellen Fall aufgestellten Grundsätze sind analog auf den in casu inkriminierten Vorwurf der Lügenhaftigkeit gewisser jüdischer Kreise, welche die Schmerzhaftigkeit des Schächtens bestreiten, anwendbar. Die Vorinstanz hat diese Grundsätze willkürlich nicht beachtet, die Rassismusstrafnorm gegen den BF diskriminierend angewendet und ihre Beweggründe hiefür nicht dargelegt (Verletzung des rechtlichen Gehörs), wodurch es dem BF einmal mehr verunmöglicht wurde, sich wirksam zu verteidigen.
Zu lit c der Anklageschrift vom 28. April 2003:
Hier wird dem BF (Erwin Kessler) vorgeworfen, in einer Bildlegende das Grinsen eines Schächters beim jüdische Schächten mit dem Grinsen von Nazischergen beim Foltern von KZ-Häftlingen verglichen zu haben. Diese Aufnahme, die auf Seite 21 der VgT-Nachrichten vom Mai 2002 wiedergegeben ist, wurde von einer Delegation des Schweizerischen Tierschutzverbandes, welcher zur Begutachtung des jüdischen Schächtens in den französischen Schlachthof in St Louis eingeladen wurde, gemacht. Ebenso die Aufnahme darunter, welche einen Zigarette rauchenden Schächter beim Schächten zeigt.
Die inkriminierte Legende zum ersten Bild lautet:
Jüdisches Schächten eines Schafes. Der sadistische religiöse Fanatiker rechts grinst dazu. So mögen Nazi-Schergen beim Foltern von KZ-Häftlingen gegrinst haben.
Dies Aufnahme mit der identischen Legende war schon einmal Gegenstand einer Rassismus-Anklage gegen den BF, zusammen mit anderen Anklagepunkten betreffend Äusserungen zum Schächten in den VgT-Nachrichten vom Januar 2001. Das Verfahren wurde von der Bezirksanwaltschaft Bülach eingestellt, wobei offen gelassen wurde, ob die eingeklagten Äusserungen den Tatbestand der Rassendiskriminierung erfüllten; mit Blick auf das vorliegende, damals schon hängige Verfahren sei deswegen jedenfalls nicht mit einer wesentlichen Zusatzstrafe zu rechnen; in Fällen, da in einem Strafverfahren ohnehin lediglich eine nicht ins Gewicht fallende Zusatzstrafe zu einer Verurteilung auszusprechen wäre, rechtfertige sich gemäss § 39a Ziff 2 StPO jedoch die Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen (Einstellungsverfügung vom 6. Dezember 2001, Zeichen: Büro A-4/2001/002001).
Nun wurde der BF genau wegen dieser Aufnahme mit identischer Bildlegende verurteilt. Ein solcher Umgang mit einer menschenrechtswidrig unbestimmten Strafnorm (siehe Ziffer 4.5) verletzt das Gebot von Treu und Glaube (BV 5.3).
Der (von der Vorinstanz nicht erhobene) Vorhalt, der BF hätte auf die Wiederholung dieser Bildlegende verzichten müssen, da ja deswegen schon einmal ein Strafverfahren eröffnet worden sei, würde eine direkte Verletzung des aus EMRK 6 fliessende strafrechtliche Bestimmtheitsgebotes darstellen, denn nach dieser Auffassung hätte er auch auf die weiteren Äusserungen verzichten müssen, welche Gegenstand jenes Verfahrens waren (siehe die Akten jenes Verfahrens). Darunter hat es aber solche, für die der BF im vorliegenden Verfahren freigesprochen wurde. Es ist genau dieser sog chilling effect, welche das Bestimmtheitsgebot vermeiden will. Es ist mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäusserung und dem Verbot der strafrechtlichen Unbestimmtheit unvereinbar, wenn vom BF verlangt wird, er müsse sich künftig jeglicher Äusserung zu enthalten, die jemals Gegenstand einer Anzeige war, wenn das Verfahren eingestellt wird ohne Klärung ob und wieweit die inkriminierten Äusserungen tatbeständlich sind.
Die Vorinstanz hat diese Einstellungsverfügung willkürlich nicht beachtet und StGB 261bis falsch angewendet, obwohl der BF bei seiner Befragung vor erster Instanz darauf hingewiesen hat (siehe Seite 48 des Protokolls der erstinstanzlichen Verhandlung).
Die Vorinstanz hat - im Widerspruch zur Einstellungsverfügung - diesen Punkt auch nicht als geringfügig beurteilt, sondern diesem offenbar bedeutendes Gewicht beigemessen.
Da die Vorinstanz das Strafmass nur pauschal und oberflächlich begründet und insbesondere keine Gewichtung der einzelnen Anklagepunkte angegeben hat, ist es dem BF praktisch verunmöglicht, sich diesbezüglich zu wehren. Die ungenügende Beachtung der Begründungspflicht mit Bezug auf das Strafmass stellt deshalb eine Verletzung der Verteidigungsrechte gemäss EMRK 6 dar.
Die erste Instanz hat diese Bildlegende als tatbeständlich beurteilt, weil damit das Schächten mit Nazi-Verbrechen verglichen werde. Das Obergericht hat den BF dann bezüglich dieses Vergleiches freigesprochen (Seite 69) und ihn mit einer neuen Begründung verurteilt, worauf zurückzukommen sein wird. Das Austauschen der Gründe - womit eine wirksame Verteidigung menschenrechtswidrig hintertrieben wurde (EMRK 6) -, warum eine Äusserung tatbeständlich sein soll, zeigt deutlich, wie sogar Richter Mühe haben, mit dieser menschenrechtswidrig unbestimmten Strafnorm umzugehen. Es zeigt sich aber auch, dass der BF aus politischen Gründen im vornherein schuldig zu sprechen war und es nur noch darum ging, eine für die Öffentlichkeit mehr oder weniger plausible Begründung vorzuschieben.
Die Vorinstanz verlangt vom BF - einem juristischen Laien -, besser als Richter und Rechtsprofessoren zu wissen, was mit Blick auf StGB 261bis noch gesagt werden darf und was nicht. Auch dies belegt wieder ganz konkret die menschenrechtswidrige Unbestimmtheit dieser Strafnorm, wie sie unter Ziff 4.5 dargelegt worden ist.
Dazu kommt, dass die Vorinstanz diese Legende in willkürlicher Weise mit gekünstelter Argumentation dahin umgedeutet und verallgemeinert hat (Seite 70), der BF werfe damit allen Schächtjuden Sadismus vor, obwohl die Bildlegende ganz konkret (nur) den abgebildeten Schächte kommentiert. Damit behauptet die Vorinstanz, alle jüdischen Schächter würden so arbeiten, beim jüdischen Schächten gehe es immer so zu und her, dass geraucht und gegrinst werde. Der BF weiss das nicht, nimmt jedoch diese richterliche Feststellung zur Kenntnis und wird - sollte sie rechtskräftig bleiben - künftig in seiner tierschützerisch-publizistischen Tätigkeit darauf hinweisen.
Die Argumentation der Vorinstanz ist zudem widersprüchlich (ein Nichtigkeitsgrund): Einerseits wird auf Seit 69 festgestellt, der in der Bildlegende enthaltene Vergleich des Schächtens mit dem Foltern von KZ-Häftlingen sei nicht tatbeständlich. Andererseits wird Seite 70 unten dann aber doch auch damit die Verurteilung begründet, indem die Vorinstanz willkürlich eine Aussage in die Bildlegende hineindeutet, welche der BF nicht geäussert hat. Damit hat sie sich über die konstante Praxis des Bundesgerichtes (BGE X c. A) hinweggesetzt, wonach "nich leichthin angenommen werden darf, dass derjenige, welcher etwas nicht ausdrücklich geäussert hat, die Möglichkeit in Kauf genommen habe, der Leser werde eine entsprechende Aussage auf dem Wege der Interpretation entnehmen". Für diese Missachtung der Bundesgerichtspraxis hat die Vorinstanz keinerlei Begründung oder Rechtfertigung angegeben. Es liegt eine falsche Anwendung von Bundesrecht vor.
Im übrigen war der BF auch in diesem Punkt nicht materiell verteidigt (siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 4.6). Dafür trägt der Staat, der ihm eine amtliche Verteidigung aufgezwungen hat, die volle Verantwortung. Die Vorinstanz hat auf Seite 75 ausdrücklich festgehalten, es sei nicht nötig, neben dem amtlichen Verteidiger auch noch einen erbetenen Verteidiger zu haben.
Dadurch, dass der BF seiner Abscheu über das völlig unreligiöse, respektlose Verhaltens eines Schächters auf einer Fotoaufnahme Ausdruck gibt, hat der BF wegen einem konkreten Verhalten und nicht wegen der Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Rasse oder Religion herabgesetzt. Der subjektive Tatbestand ist deshalb nicht erfüllt. (Nach Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3. Auflage, Seite 219, ist für den subjektiven Tatbestand der Wille des Täters erforderlich, "mit seinem Verhalten jemanden oder eine Personenmehrheit unter Berufung auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, Rasse oder Religion herabzusetzen...".) Die vorinstanzliche Verurteilung, obwohl der subjektive Tatbesand nicht erfüllt ist, ist willkürlich und verletzt die bundesrechtlichen Voraussetzungen der Strafbarkeit.
Im übrigen trifft auf die Schächter auf diesen Fotos zu, was den Naziverbrechern im Nürnberger Urteil vorgeworfen wurde: "Das Böse ist die Abwesenheit von Mitgefühl."
Das vorinstanzliche Urteil beruht wesentlich auf der Einstellung der vorinstanzlichen Richter, dass jüdische Massenverbrechen gegen die Menschlichkeit nicht kritisiert werden und insbesondere nicht mit anderen Unmenschlichkeit verglichen werden dürfen. Diese Einstellung der vorinstanzlichen Richter ist rassendiskriminierend - leider nicht im juristischen Sinn, aber absolut im ethisch-moralischen; es handelt sich um eine verwerfliche, sachlich nicht berechtigte und allein an der ethnisch-religiösen Zugehörigkeit orientierte Ungleichbehandlung. Diese Richter sollten besser mal vor ihrer eigenen Türe wischen, bevor sie andere verurteilen.
Diese angebliche Unvergleichbarkeit alles Jüdischen hat der jüdisch-amerikanische Politologe Prof Norman Finkelstein in seinem Buch die "Holocaust-Industrie" (im ersten erstinstanzlichen Verfahren zu den Akten gegeben) überzeugend kritisiert. Er beschreibt, wie der Holocaust des Zweiten Weltkrieges von jüdischen Kreisen als politische Waffe missbraucht wird, um Geld zu erpressen und jegliche Kritik an jüdischem Verhalten zu tabuisieren. Finkelsteins Eltern überlebten das Warschauer Ghetto und die Konzentrationslager Auschwitz und Majdanek. Seine gesamte übrige Verwandtschaft kam in Treblinka um. Die Nazis zu entlasten ist also mit Sicherheit nicht Finkelsteins Anliegen. Dennoch äussert er in seinem Buch Meinungen, für die ein Nichtjude in der Schweiz nach gegenwärtiger Unrechtsprechung sofort ins Gefängnis käme. Nach seinem Vortrag in Zürich blieb die Justiz jedoch untätig und sein Buch ist frei im Buchhandel erhältlich. Es kommt eben in diesem Unrechtsstaat nicht darauf an, WAS gesagt wird, sondern WER etwas sagt.
Finkelstein wirft jüdischen Organisationen vor, den Holocaust als politische Waffe zu missbrauchen. Er bezeichnet dies als "Holocaust-Industrie". Man habe sich auf diese Weise einen unverdienten Status der Unantastbarkeit angeeignet und versuche im Namen der Holocaust-Überlebenden unangemessen viel Geld von Unternehmen und ganzen Völkern zu erstreiten. Dabei werde sogar absichtlich mit Lügen über angebliche Nazi-Greuel gearbeitet. Finkelsteins Thesen sind ein Angriff auf den Glaubensgrundsatz, dass der Holocaust ein einzigartiges Ereignis gewesen sei, mit nichts anderem in der Weltgeschichte vergleichbar. Dieser Glaube, an dem nur wenige Menschen zu rütteln wagen, werde von gewissen Juden rücksichtslos dazu benutzt, die erschreckenden Menschenrechtsverstösse von Israel zu rechtfertigen und ein Klima der Angst zu schaffen, in welchem niemand - weder in der Wissenschaft noch in der Politik - den Holocaust ehrlich und vernünftig diskutieren könne. An einigen Universitäten sei diese Political Correctness so extrem geworden, dass man bereits als Holocaustleugner tituliert werde, wenn man die Nazi-Konzentrationslager mit dem Schicksal von zehn Millionen Afrikanern vergleiche, die im Belgisch-Kongo als Folge des europäischen Elfenbein- und Gummihandels abgeschlachtet worden waren.
Wörtliche Zitate aus dem Buch "Holocaust-Industrie" von Prof Finkelstein (die Seitenangaben beziehen sich auf die zu den Akten gegebene deutsche Erstausgabe, Piper Verlag, 2001):
Aus dieser scheinbar bestechenden Opferrolle erwachsen beträchtliche Dividenden - insbesondere die Immunität gegenüber Kritik, wie berechtigt sie auch sei. (Seite 9)
Es ist schon seit langer Zeit überfällig, dass wir unser Herz für das Leiden der übrigen Menschheit öffnen. Das war die wichtigste Lektion, die mir meine Mutter auf den Weg gab. Niemals hörte ich sie sagen: Du sollst nicht vergleichen. Meine Mutter stellte immer Vergleiche an. Zweifellos muss man historische Unterschiede machen. Doch wenn man moralisch zwischen unseren und den Leiden jener unterscheidet, ist das selbst eine moralische Farce. (Seite 15)
Diese Aussage Finkelsteins ist deshalb bemerkenswert, weil der BF verurteilt wurde, weil er das Schächten mit Nazi-Greueln verglichen habe.
Weitere Zitate aus dem Buch:
Die Berufung auf den Holocaust war deshalb ein Trick, jeglicher Kritik an Juden die Legitimation zu entziehen. (Seite 46)
In der Behauptung von der Einzigartigkeit des Holocaust ist auch enthalten, dass DER HOLOCAUST einzigartig böse gewesen sei. Die Leiden anderer, wie schrecklich auch immer, seien damit einfach nicht zu vergleichen... Die Behauptungen, dass der Holocaust einzigartig sei, sind intellektuell unfruchtbar und moralisch verwerflich, doch sie bleiben bestehen. Die Frage lautet, warum? Zunächst verleiht einzigartiges Leid einen einzigartigen Anspruch. Das unvergleichlich Böse des Holocaust sondert die Juden ... nicht nur von den anderen ab, sondern gibt den Juden auch einen Anspruch gegenüber diesen anderen. (Seite 55)
Es spielt noch ein anderer Faktor mit. Die Behauptung der Einzigartigkeit des Holocaust ist auch die Behauptung der jüdischen Einzigartigkeit. Nicht das Leiden der Juden machte den Holocaust so einzigartig, sondern die Tatsache, dass die Juden litten. Der Holocaust ist etwas Besonderes, weil Juden etwas Besonderes sind. (Seite 56)
Ungeachtet des ganzen Rummels gibt es keinen Beleg, dass die Leugner des Holocaust ... einen nennenswert grösseren Einfluss ausüben als die Gesellschaft zur Unterstützung der Hypothese, die Erde sei nicht rund, sondern eine Scheibe. Angesichts des Unsinns, den die Holocaust-Industrie täglich auf den Markt wirft, wundert man sich eher, warum es so wenige Skeptiker gibt. Das Motiv hinter der Behauptung, die Leugnung des Holocaust sei weit verbreitet, ist leicht zu finden. Wie anders sollte man in einer Gesellschaft, die bis oben hin mit dem Holocaust gesättigt ist, immer noch weiter Museen, Bücher, Lehrpläne, Filme und Programme rechtfertigten, als damit, das Gespenst der Leugnung des Holocaust heraufzubeschwören? (Seite 75)
Sowohl Arno Mayer in seiner bedeutenden Studie über die Massenvernichtung der Juden durch die Nazis als auch Raul Hilberg zitieren Veröffentlichungen, die den Holocaust leugnen. 'Wenn diese Leute reden wollen, soll man sie lassen', meint Hilberg. 'Das bringt jene von uns, die Forschung betreiben, dazu, Dinge, die wir vielleicht als offensichtlich erachtet haben, erneut zu überprüfen. Und das ist nützlich für uns alle.' (Seite 79)
Wenn jeder, der behauptet, ein Überlebender der Lager zu sein, wirklich einer ist', pflegte meine Mutter auszurufen, 'wen hat Hitler denn umgebracht?' (Seite 85)
In einem Beitrag für eine Holocaust-Website meinte einer, er sei, obwohl er die Zeit des Krieges in Tel Aviv verbracht hatte, ein Holocaust-Überlebender, weil seine Grossmutter in Auschwitz umgekommen ist... Das Büro des israelischen Premierministers... bezifferte die Zahl der noch lebenden Holocaust-Überlebenden auf fast eine Million. Das Hauptmotiv hinter dieser inflationären Änderung ist auch hier leicht zu finden. Es ist schwierig, neue umfangreiche Ansprüche auf Wiedergutmachung durchzusetzen, wenn nur noch wenige Opfer des Holocaust am Leben sind. (Seite 87)
Vor kurzem versuchte die Claims Conference, sich reprivatisiertes jüdisches Eigentum in den neuen Bundesländern im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar anzueignen, das von Rechts wegen lebenden jüdischen Erben zusteht. Als die Konferenz deswegen und wegen anderer Missstände von betrogenen Juden angegriffen wurde, verwünschte Rabbi Arthur Hertzberg beide Seiten und höhnte, dass 'es nicht um Gerechtigkeit geht, es ist ein Kampf ums Geld'. Wenn die Deutschen oder die Schweizer sich weigern, Entschädigungen zu zahlen, kann der Himmel die gerechte Entrüstung der organisierten Juden nicht fassen. Doch wenn jüdische Eliten jüdische Überlebende berauben, kommen keine ethischen Fragen auf. (Seite 92)
Was meine Mutter für sechs Jahre Leiden unter der Nazi-Verfolgung erhielt, kassiert... D'Amato in zehn Stunden. (Seite 92)
Für jene, die sich für mehr Menschlichkeit einsetzen, schliesst ein Prüfstein des Bösen Vergleiche nicht aus, sondern lädt eher noch dazu ein. In der moralischen Welt des späten neunzehnten Jahrhunderts nahm die Sklaverei in etwa die gleiche Stellung ein, wie die Massenvernichtung der Juden durch die Nazis. Dementsprechend wurde sie oft herangezogen, um Missstände zu illustrieren, die nicht in ihrem vollen Ausmass anerkannt wurden.... 'Das kann man nicht vergleichen' ist der Glaubenssatz moralischer Erpresser. (Seite 151)
Wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden ist der BF (Erwin Kessler) genau wegen solcher - sachlich begründeter - Vergleiche, welche die Holcocaust-Industrie tabuisieren will.
Wenn ein bekannter Tierschützer wegen seiner Kritik an einer grausamen, tierquälerischen Tradition zu Gefängnis verurteilt wird, ist das in einem freiheitlich-demokratischen Staat von erheblichem öffentlichem Interesse. Es muss erlaubt sein, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Man darf jedenfalls gespannt sein, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dies beurteilen wird, sollten die nationalen Gerichte dieser monströsen Anklage folgen. Nach konstanter Praxis des Menschenrechts-Gerichtshofes müssen Eingriffe in die Meinungsäusserungsfreiheit nicht nur auf einer gesetzlichen Grundlage basieren, sondern im konkreten Fall auch notwendig sein zur Aufrechterhaltung einer freiheitlich-demokratisch Gesellschaft. Beide Voraussetzungen sind hier nicht gegeben: Erstens liegt keine Rassendiskriminierung vor, weshalb der Rassismus-Artikel keine gesetzliche Grundlage bietet, und zweitens gefährdet nicht die Äusserung des BF, sondern der willkürliche Eingriff in die Äusserungsfreiheit die Aufrechterhaltung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates.
Man kann den Schutz von (perversen) Minderheiten auch übertreiben. Die Mehrheit hat auch einen Anspruch, vor solchen Minderheiten geschützt zu werden.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bis jetzt erst einen der hängigen Fälle des BF beurteilt und ist dabei zu einer einstimmigen Verurteilung der Schweiz gekommen. Es ging dabei auch um die Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit: Zensur eines Tierschutz-Spots durch das Schweizer Fernsehen, abgesegnet von Bundesrat Leuenberger und vom Bundesgericht. In diesem Urteil misst der Gerichtshof der Meinungsäusserungsfreiheit gemäss ständiger Praxis grosse Bedeutung bei. Wörtlich heisst es im Urteil aus Strassburg, in welchem dem BF 20 000 Franken Entschädigung zugesprochen wurde (www.vgt.ch/justizwillkuer/tvspot-zensur.htm):
Der Gerichtshof ruft in Erinnerung, dass die Meinungsäusserungsfreiheit eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und eine Grundvoraussetzung für deren Fortschritt und die individuelle Selbstverwirklichung darstellt. Gemäss Artikel 2 Absatz 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention gilt die Meinungsäusserungsfreiheit nicht nur für Informationen oder Ideen, die gerne gehört oder als nichtoffensiv oder indifferent angesehen werden, sondern auch für solche, welche angreifen, schockieren und stören. Das verlangen Pluralismus, Toleranz und offener Geist, ohne die es keine demokratische Gesellschaft geben kann. Artikel 10 sieht Ausnahmen von der Meinungsäusserungsfreiheit vor. Solche Ausnahmen müssen jedoch streng ausgelegt werden und die Notwendigkeit für jede Einschränkung muss überzeugend dargelegt werden, vorallem wenn es der Natur nach um politische, nicht um kommerzielle Äusserungen geht.
Der Vergleich jüdischer Tierquäler mit Naziverbrechern, die dem BF aus politischen Gründen und unter krasser Rechtsbeugung als rassendiskriminierend vorgehalten werden, sind so treffend und richtig, dass darauf nicht verzichtet werden kann, solange in der Schweiz Schächtfleisch tonnenweise konsumiert wird. Im Jahr 2000 wurden gemäss Zollstatistik 161 Tonnen jüdisches Schächtfleisch in die Schweiz importiert. Dazu kommen die Hühner, die in einer Luzerner Geflügelschlächterei jede Woche für die jüdische Cultusgemeinde Zürich legal bei vollem Bewusstsein geschächtet werden. Der Bundesrat wollte auch noch das Schächten von Säugetieren in der Schweiz erlauben - erklärtermassen nicht deshalb, weil dies keine Tierquälerei wäre, sondern als politisches Zugeständnis an die Juden unter dem Vorwand der Religionsfreiheit. Wie sich der Bundesrat von jüdischen Kreisen erpressen lässt, ist bekannt und es kann nicht dazu geschwiegen werden, wenn derart feige Politik auf Kosten wehrloser Mitgeschöpfe betrieben wird.
An dieser Stelle ist eine kurze Erklärung am Platz: Warum wird der BF immer nur wegen Kritik am jüdischen Schächten angeklagt und verurteilt? Es wäre falsch daraus zu schliessen, er kritisiere nur die Schächtjuden, nicht aber die schächtenden Moslems. Vielmehr ist es einfach so, dass nur seine Kritik am jüdischen Schächten nicht "politisch korrekt" ist und deshalb mit dem Mittel der Justiz unterbunden werden muss. Im ersten Schächtprozess wurde er wegen eines Satzes, in dem er gleichermassen Juden und Moslems kritisierte, nur wegen Rassendiskriminierung gegenüber den Juden angeklagt und verurteilt. Der Satz lautete:
Ein Massenverbrechen bleibt ein Verbrechen, auch wenn es mit Ideologien gerechtfertigt wird. Die Nazis hatten ihre Ideologie, den Arierwahn, orthodoxe Juden und Moslems haben eine andere, ebenfalls bestialische Ideologie. Rechtfertigt diese den Schächtholocaust?
Die Verurteilung wegen dieser Äusserung erfolgte, weil angeblich rassendiskriminierend gegenüber Juden. Dass gleichermassen auch Moslems erwähnt sind, fand keine Beachtung. Und diese diskriminierende Rechtsprechung wurde bis hinauf zum Bundesgericht geschützt (www.vgt.ch/justizwillkuer/schaecht-prozess.htm). Das zeigt mit aller Deutlichkeit, dass es nicht wirklich um Rassendiskriminierung geht, sondern um politische Repressionen mit dem Mittel der Willkürjustiz.
Der BF wurde zu Gefängnis verurteilt, weil er seine Abscheu darüber ausdrückte, dass auf einer Fotoaufnahme ein jüdischer Schächter grinst, während er einem Schaf bei vollem Bewusstsein die Kehle durchsäbelt. (Eine in der inkriminierten Veröffentlichung daneben stehende Aufnahme zeigt einen jüdischen Schächter, wie er bei seiner grauenhaften "heiligen" Handlung eine Zigarette im Munde hat.) Es kann nicht im Ernst bestritten werden, dass der BF objektive Gründe hatte, dies als abscheulich zu verurteilen. Die Vorinstanz hat den oben zitierten BGE 6S.64/2004 (Urteil Scherrer) auch hier willkürlich nicht beachtet, die Rassismusstrafnorm diskriminierend angewendet und seine Beweggründe für die Nichtbeachtung dieses BGE unter Verletzung der Begründungspflicht nicht dargelegt. Dadurch wird eine wirksame Verteidigung auch in diesem Punkt unzulässig behindert - und das, nachdem der BF schon in den beiden Vorinstanzen nicht materiell verteidigt war.
5. Gerichtsberichterstattung zum Fall Graf - bundesrechtswidrige, willkürliche Auslegung von StGB 27.2 und Verletzung der Medienfreiheit
5.1
StGB 27 erklärt klar und eindeutig und vorbehaltlos die wahrheitsgemässe Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen als straflos. Zur Tatzeit war diese noch völlig unbestritten. Erst später - ausgelöst durch einen umstrittenen BGE, wonach dies nicht gelten soll, wenn an einer Gerichtsverhandlung rassendiskriminierende Äusserungen verhandelt werden (siehe Gutachten Riklin, bei den Akten) - entstand darüber ein Kontroverse. Das Obergericht hat sich zwar in der Urteilsbegründung von diesem von der Lehre mehrheitlich abgelehnten BGE distanziert, den Angeklagten jedoch trotzdem für schuldig befunden. Zur Begründung hat das Obergericht eine eigene, neue Auslegung von StGB 27 vorgebracht (Seite 50ff). Diese Begründung wird von Prof Riklin in einer Ergänzung zu seinem Gutachten als unhaltbar und widersprüchlich zurückgewiesen zurückgewiesen (siehe auch seinen Medialex-Aufsatz in Beilage 14 mit zusätzlichen, neuen Quellen):
Ergänzungsgutachten von Prof F Riklin
Sehr geehrter Herr Kessler,
im Verlaufe des Jahres 2004 haben Sie mich gebeten, im Zusammenhang mit einem vor dem Züricher Obergericht gegen Sie hängigen Strafverfahren eine gutachtliche Stellungnahme zur Frage abzugeben, ob die Wiedergabe von Teilen eines Gerichtsprotokolles und eines Medienberichts über eine Gerichtsverhandlung im Internet nach der Rassismusnorm strafbar sei, wenn diese Berichte auch als rassendiskriminierend bewertete Aussagen enthalten, die an der Gerichtsverhandlung gemacht wurden.
Ich habe gemäss diesem Auftrag zu der gestellten Frage mit Datum vom 24.8.2004 ein Gutachten erstattet (nachfolgend "Hauptgutachten" genannt). Dieses Hauptgutachten bezog sich auf Ziff. I der Nachtragsanklageschrift vom 8.8.2000 der Bezirksanwaltschaft Zürich im erwähnten Strafverfahren.
Mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 29.11.2004 sind Sie auch in diesem Punkt schuldig gesprochen worden.
Im Hinblick auf das bevorstehende bundesgerichtliche Verfahren haben Sie mich gebeten, ein Ergänzungsgutachten unter Berücksichtigung der Argumentation des Obergerichts des Kantons Zürich gemäss Urteil vom 29.11.2004 zu erstatten.
Ich komme diesem Auftrag hiemit nach. Meine Ausführungen befassen sich nur mit dem erwähnten Anklagepunkt. Sie gliedern sich wie folgt:
I. Einleitung und Rekapitulation
II. Kritik an der Argumentation des Zürcher Obergerichts
III.Schlussfolgerungen
I. Einleitung und Rekapitulation
1. Der Einfachheit halber verweise ich zunächst auf mein Hauptgutachten vom 24.8.2004, das Gegenstand der Gerichtsakten ist (Urk. 89/1). Ich setze es im Folgenden grundsätzlich als bekannt voraus. Ferner nahm ich dieses Gutachten zum Anlass, um in der Zeitschrift medialex für das Heft 1/2005, S. 34 ff. einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema "Zur Berichterstattung über Aussagen und Bildern mit strafbarem Inhalt" zu publizieren. Ich tat dies unter Ausklammerung der besonderen Gegebenheiten des Falles Kessler, weil es mir nicht darum ging, zum Fall Kessler einen Aufsatz zu verfassen, sondern zu der dahinter stehenden Grundfrage, wieweit eben eine Berichterstattung über Aussagen und Bilder mit strafbarem Inhalt zulässig ist. Ich lege diesen Aufsatz diesem Ergänzungsgutachten bei. Es berücksichtigt weitere in meinem Hauptgutachten noch nicht ausgewertete Literatur, so etwa die Dissertation Peduzzi über Meinungs- und Medienfreiheit in der Schweiz sowie den deutschen Medienrechtsklassiker Wenzel über das Recht der Wort- und Bildberichterstattung.
2. Obwohl ich wie erwähnt die Kenntnis meines Hauptgutachtens als bekannt voraussetze, seien nochmals kurz ein paar Kernaussagen rekapituliert:
Streitgegenstand ist die Wiedergabe wesentlicher Teile des Protokolls der Hauptverhandlung gegen Gerhard Förster und Jürgen Graf vom 21.7.1998 vor Bezirksgericht Baden sowie eines "Berichts über den Strafprozess gegen Gerhard Förster und Jürgen Graf wegen ‚Rassendiskriminierung’ in Baden (Schweiz) am 6.6.1998 von Xaver März."
In diesem Gerichtsprotokoll und dem Bericht März kommen u.a. die verhandelten "revisionistischen" Veröffentlichungen des Beschuldigten Graf zur Sprache.
Der Ausdruck des von Kessler erstellten Protokolls der Verhandlung vor Bezirksgericht Baden umfasst 51 A4-Textseiten und rund 2000 Zeilen. Das erste Zitat mit angeblich rassendiskriminierendem Inhalt gemäss Anklageschrift findet man auf der zwanzigsten Textseite.
In der Anklageschrift werden etwa 190 Zeilen mit angeblich rassendiskriminierenden Äusserungen aus dem Protokoll zitiert. Das sind weniger als 10% des gesamten Protokolls. Nicht ganz die Hälfte der zitierten (nach Meinung der Staatsanwaltschaft) rassendiskriminierenden Aussagen sind nicht Aussagen von Graf an der Gerichtsverhandlung, sondern Passagen aus dem Schrifttum von Graf, welche diesem durch eine Drittperson (vermutlich die Gerichtspräsidentin oder den Staatsanwalt) vorgehalten wurde.
Der Bericht März umfasst 16 Textseiten. In der Anklageschrift befinden sich davon insgesamt 32 Zeilen, das sind rund 5% des 16-seitigen Dokuments.
Die Anklageschrift ging fälschlicherweise davon aus, dass die Wiedergabe rassendiskriminierender Aussagen in einem Verhandlungsbericht per se strafbar sei.
Subjektiv warf man Kessler vor, er habe bewusst oder billigend in Kauf genommen, dass in den wiedergegebenen Inhalten Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit geleugnet oder gröblich verharmlost würden und beim durchschnittlichen Leser der Eindruck entstehen müsse, er bezwecke mit der Wiedergabe dieser Inhalte die Verbreitung rassistischer Meinungen, während sonstige Anliegen nicht im Vordergrund stünden.
Im Hauptgutachten und im medialex-Artikel habe ich dargelegt und dokumentiert, dass es gang und gäbe ist, bei der Berichterstattung über Gerichtsverfahren und andere die Öffentlichkeit interessierende Ereignisse als deliktisch angesehene Aussagen oder Bilder wiederzugeben, so etwa bei Berichten über Ehrverletzungen, UWG-Zuwiderhandlungen, pornographische Publikationen, die Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, aber auch über Verstösse gegen die Rassismusnorm. Dies könne gestützt auf die Kommunikationsfreiheitsrechte in Verbindung mit dem Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen oder über Art. 27 Abs. 4 StGB, der die wahrheitsgetreue Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen einer Behörde als straflos erklärt, zulässig sein. Eine Bestrafung komme nur aus schwerwiegenden Gründen in Frage. Das massgebende Kriterium, um die Wiedergabe solcher Aussagen zu pönalisieren, sei der Missbrauch.
Was die Rassismusnorm anbetrifft, habe ich ausgeführt, der Einwand wäre unbehelflich, die Regelung des Art. 27 StGB und damit auch sein Absatz 4 gelte gemäss der bundesgerichtlichen Praxis (BGE 125 IV 211 f.; 126 IV 177) bei Art. 261bis StGB nicht. Abgesehen davon, dass die bundesgerichtliche Annahme, ein Verstoss gegen Art. 261bis StGB sei kein Mediendelikt i.S. von Art. 27 StGB, in der juristischen Literatur überwiegend kritisiert werde, sei das, was Art. 27 Abs. 4 StGB regelt, auch gültig, wenn es die Norm nicht gäbe. Art. 27 Abs. 4 StGB kodifiziere lediglich einen klassischen Anwendungsfall des Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen, kodifiziere also etwas, was ohnehin gelte.
Ich führte neben dem Jersild-Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 23.9.1994 (wonach eine Sendung über eine rechtsextreme Jugendgruppe, die grösstenteils aus unkommentierten rassistischen Aussagen der Gruppenmitglieder bestand, als EMRK-konform bezeichnet wurde) namentlich auch Autoren an, die zur Missbrauchsthese in Bezug auf die Rassismusnorm Stellung nehmen. Niggli meint in seinem Kommentar über die Rassismusnorm, man werde sich nicht darauf berufen können, man wolle nur informieren, wenn eine ganze Nummer einer Zeitung oder Zeitschrift oder eine halbstündige oder stündige Radio- und Fernsehsendung ausschliesslich oder fast ausschliesslich aus der Wiedergabe von strafbaren Äusserungen bestehe (N 639). Was die Frage anbetrifft, ob in einem solchen Fall eine Distanzierung von der wiedergegebenen Aussage erfolgen müsse, vertritt ebenfalls Niggli die Meinung, es wäre zu einfach, grundsätzliche Strafbarkeit anzunehmen, wenn ein rassistischer Aufruf wiedergegeben würde, ohne dass sich der Berichtende davon distanziere; sonst wären selbst Agenturmeldungen, die über rassendiskriminierende Aufrufe rapportieren, strafbar, wenn die Meldung nicht mit der Floskel "wir halten dies für falsch" versehen wäre, und das könne nicht richtig sein (N 630).
Ich erwähnte ferner, dass Niggli den Jersild-Entscheid des EGMR zwar kritisiert, weil in diesem Fall erst durch das Mitwirken der Journalisten das Verhalten der Jugendlichen überhaupt öffentlich und damit tatbestandsmässig wurde (N 642 ff.). Aber auch für Niggli präsentiert sich die Sachlage anders, wenn über einen Sachverhalt berichtet wird, der für sich allein schon tatbestandsmässig und strafbar ist (N 647). Er erklärt, wenn mit Fug und Recht die Informationsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit und Pressefreiheit in Anspruch genommen werde, um einen Sachverhalt zu vermitteln, der selbst von Art. 261bis StGB erfasst werde, so werde dies häufig kaum möglich sein, ohne die rassendiskriminierenden Äusserungen wiederzugeben (N 628).
II. Kritik an der Argumentation des Zürcher Obergerichts
1. Das Zürich Obergericht ging zu Recht davon aus, dass es in den fraglichen Berichten um eine öffentlich durchgeführte Gerichtsverhandlung ging und dass es sich beim Internet um ein Medium handelt (Urteil, S. 48). Ferner war das Obergericht grundsätzlich ebenfalls der Meinung, dass nur im Fall des Missbrauchs die Wiedergabe einer strafbaren Äusserung aus einer Gerichtsverhandlung strafbar sein könne (vgl. Urteil, S. 49). Zu Recht wurde auch festgehalten, dass der Missbrauch anhand der gesamten Umstände der konkret in Frage stehenden Publikation zu beurteilen sei (Urteil, S. 49).
2. Widersprüchlich und diffus äusserte sich jedoch das Züricher Obergericht zu anderen einschlägigen Fragen und zur subjektiven Seite.
3. Was die Anwendbarkeit von Art. 27 Abs. 4 StGB anbetrifft, führte das Zürcher Obergericht auf S. 48 des Urteils aus, an sich seien die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 4 StGB erfüllt, jedoch sei nach der bundesgerichtlichen Praxis diese Bestimmung auf die Verbreitung rassendiskriminierender Äusserungen nicht anwendbar, weil Art. 261bis StGB gerade erlassen worden sei, um die öffentliche Kundgabe zu verbieten (BGE 125 IV 211 f.; 126 IV 177).
Dazu ist zu bemerken, dass in Art. 27 StGB zwei Themen geregelt sind, die Kaskadenhaftung sowie die Regelung von Absatz 4. Die erwähnten Bundesgerichtsentscheide sind so zu interpretieren, dass das Bundesgericht in Bezug auf Art. 261bis Abs. 2 und 4 StGB die Kaskadenhaftung nicht angewendet haben wollte (wegen der Fehlmeinung, sonst könnte man den Autor einer rassendiskiminierenden Publikation nicht bestrafen). Zu Art. 27 Abs. 4 StGB hat sich das Bundesgericht in diesem Zusammenhang konkret nicht geäussert. Wie erwähnt (vgl. vorne I Ziff. 2) bin ich der Meinung, dass das, was in Art. 27 Abs. 4 StGB steht, gestützt auf die Kommunikationsfreiheitsrechte (Medienfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit) ohnehin gelten würde. Was Art. 27 anbetrifft geht es nicht an, die Bestimmung entgegen ihrem eindeutigen Wortlaut zu interpretieren, sondern man darf sie höchstens im Falle eines eklatanten Missbrauchs nicht anwenden.
Das Zürcher Obergericht äusserte sich in der Folge zur Anwendbarkeit von Art. 27 Abs. 4 StGB ganz ambivalent. Es führte aus, würde dieser Absatz uneingeschränkt Platz greifen, könnte der Zweck des Verbots der Rassendiskriminierung unterlaufen werden, indem entsprechende Äusserungen ausgerechnet auf die wirksamste Weise, nämlich über die Medien, praktisch beliebig straflos verbreitet werden dürften, sobald sie einmal in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung gemacht worden wären (Urteil, S. 48 f.). Art. 27 dürfe nicht zur Umgehung des Rassendiskriminierungsverbots missbraucht werden (Urteil, S. 49). Andererseits meinte das Gericht, bei der Gerichtsberichterstattung müsse es der Presse möglich bleiben, auch in Berichten über Strafprozesse wegen Rassendiskriminierung einigermassen substantiiert darzulegen, was Gegenstand der Anklage war, ohne deswegen selber eine Strafverfolgung zu riskieren. Dass dabei gewisse rassendiskriminierende Äusserungen zumindest im Kerngehalt einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden, sei mit Blick auf die Pressefreiheit in Kauf zu nehmen, ansonst diese in unverhältnismässigem Masse eingeschränkt würde. Auch unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten müsse eine Berichterstattung über derartige Gerichtsverfahren unter Einschluss von Angaben über den Gegenstand des Prozesses zulässig sein. Sonst würde die Tätigkeit der Strafjustiz in diesem Bereich dem Einblick des grössten Teils der Bevölkerung entzogen (Urteil, S. 49).
Im Ergebnis behauptete das Züricher Obergericht, nach Art. 27 Abs. 4 StGB sei es zulässig, eine Rassendiskriminierung, die Gegenstand eines Prozesses sei, "einigermassen substantiiert darzulegen", indem "gewisse rassendiskriminierende Äusserungen" "zumindest im Kerngehalt" bekannt gegeben werden. Diese Einschränkungen sind wie bereits angetönt vom Gesetzestext des Art. 27 Abs. 4 nicht erfasst. Selbst wenn man Einschränkungen für den Fall des Missbrauchs akzeptiert, bliebe völlig unklar, was die Floskeln des Züricher Obergerichts konkret bedeuten, einerseits bei Gerichtsberichten über Verstössen gegen die Rassismusnorm, aber auch dann, wenn Aussagen oder Bilder, die Gegenstand eines Prozesses sind, andere Rechtsnormen verletzen. Was müsste Kessler für Folgerungen daraus ableiten, wenn er wieder einmal über einen Rassendiskriminierungsprozess berichten möchte?
4. Widersprüchlich und diffus sind auch die Ausführungen des Züricher Obergerichts zur subjektiven Seite. Wenn man die Missbrauchsthese übernimmt, könnte gestützt auf die subjektive Seite ein Missbrauch bejaht werden, wenn es dem Beschuldigten primär darum ging, rassendiskriminierendes Gedankengut zu propagieren und andere Anliegen nicht oder nur zum Schein im Vordergrund standen.
Im Urteil wird Kessler zunächst attestiert, dass es ihm letztlich um politische Anliegen ging. Nach dem Hinweis, der Beschuldigte habe im Verfahren erklärt, es sei ihm um die Meinungsäusserungsfreiheit und die Gewährleistung eines fairen Verfahrens auch bei Anklagen wegen Rassendiskriminierung gegangen (Urteil, S. 46), erklärte das Züricher Obergericht, es sei dem Beschuldigten dessen Behauptung nicht zu widerlegen, dass er keinerlei Sympathie für den Nationalsozialismus hege und sich mit Grafs Äusserungen nicht identifizieren könne. Er habe schon anlässlich der inkriminierten Publikation betont, dass er die Geschichtsauffassung der Holocaustleugner nicht teile, aber für das Recht auf freie Meinungsäusserung kämpfe (Urteil, S. 47). Erwähnt werden ferner persönliche Anmerkungen von Kessler zu seinen beiden Veröffentlichungen. Er habe u.a. auf die damals laufende Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative zur Abschaffung des Art. 261bis StGB hingewiesen und ausgeführt, dass das gegen Graf geführte Verfahren ein Prozess gegen einen Andersdenkenden sei, der niemandem etwas zu Leide getan, sondern bloss eine von der offiziell-staatlichen Geschichtsschreibung abweichende Meinung vertreten habe. Dieser Fall zeige auf, dass die Abschaffung des "Antirassismusmaulkorbgesetzes" notwendig sei. Mit den sog. "Holocaustleugnern" verbinde ihn einzig das gemeinsame Schicksal der politischen Verfolgung. Er vertrete nicht deren Geschichtsauffassung, sondern kämpfe für die freie Meinungsäusserung (vgl. Urteil, S. 51). Das Thema des Prozesses ist laut Zürcher Obergericht für den VgT und dessen Anhängerschaft im Zusammenhang mit dem tierschützerischen Engagement gegen das Schächten und auch mit Blick auf die politischen Bemühungen zur Abschaffung des Art. 261bis StGB durchaus aktuell gewesen (Urteil, S. 51).
Auf S. 53 des Urteils führte das Zürcher Obergericht sogar aus, die Aussage von Kessler, er teile die Geschichtsauffassung der "Holocaustleugner" nicht, es gehe ihm vielmehr um das Recht auf freie Meinungsäusserung und er habe aufzeigen wollen, dass Art. 261bis StGB als Instrument der politischen Verfolgung missbraucht werde und abgeschafft werden müsse, sei durchaus glaubhaft! Als Detail verwies das Zürcher Obergericht auf den Umstand, dass Kessler auf die Wiedergabe der Aussagen des Angeklagten Förster mit der Begründung verzichtete, diese seien bzgl. des unfairen Verfahrens weniger interessant.
Mit diesen Ausführungen ging das Gericht somit davon aus, es sei erwiesen bzw. nicht widerlegt, dass Kessler von seinem Recht auf freie Meinungsäusserung Gebrauch gemacht und mit der Urteilspublikation politische Ziele verfolgt hat.
Diese Feststellungen werden jedoch an anderer Stelle des Urteils in ihr Gegenteil verkehrt, indem – auf Kessler gemünzt – gesagt wird, wenn der Täter rassendiskriminierende Inhalte ins Zentrum seiner Ausführungen rücke, sei davon auszugehen, dass ihre Weiterverbreitung sein eigentliches Ziel sei. In solchen Fällen sei die Berufung auf Art. 27 Abs. 4 StGB missbräuchlich, weil sie einzig dazu diene, Art. 261bis StGB zu umgehen (Urteil, S. 51).
Noch weiter ging das Urteil auf S. 48: Selbst wenn es Kessler nur darum gegangen sei, das angeblich unfair geführte Strafverfahren gegen Graf zu kritisieren, vermöchte dies an der objektiven und subjektiven Tatbestandsmässigkeit seines Vorgehens i.S. von Art. 261bis StGB nichts zu ändern. Wer solche Texte – zwar mit der Anmerkung, sie entsprächen nicht seiner Auffassung – im Internet publiziere, nehme in Kauf, die darin enthaltene massive Verunglimpfung der Juden und die gröbliche Verharmlosung des an ihnen begangenen Genozids weiterzuverbreiten und möglicherweise ihre Wirkung zu verstärken.
Die Widersprüche zum zuvor Gesagten liess das Zürcher Obergericht im Raume stehen.
5.Unhaltbar sind die Ausführungen des Zürcher Obergerichts über legitime Zwecke der Wiedergabe strafbarer Äusserungen. Es meinte, es spiele auch der Zweck der Veröffentlichung und die allenfalls erkennbare Einstellung des Berichterstatters zu den rassendiskriminierenden Äusserungen, die er in seinen Publikationen wiedergebe, eine Rolle. Wer vor rassistischen Umtrieben warnen und diese anprangern wolle, komme nicht umhin, diese auch zu beschreiben. Ebensowenig lasse sich dies im Rahmen rechtswissenschaftlicher Publikationen zu Art. 261bis StGB vermeiden. Selbst eine relativ ausführliche Wiedergabe entsprechender Aussagen müsse zu solchen Zwecken erlaubt bleiben (Urteil, S. 51 f.). Im Fall Kessler geht es, wie auch das Zürcher Obergericht anerkannte (vgl. oben II Ziff. 4 Abs. 2 und 3), um eine politische Zielsetzung, den Schutz der freien Meinungsäusserung, der Kampf gegen das Schächten und um den Tierschutz. Dabei kann es keine Rolle spielen, ob man diese Zielsetzung persönlich teilt oder nicht. Es muss auch möglich sein, rassendiskriminierende Äusserungen wiederzugeben, um den Gesetzgeber und die Justiz zu kritisieren. Es wäre nicht angängig, so zu tun, es sei nur dann legitim, solche Äusserungen wiederzugeben, wenn man vor ihnen warnen will oder wenn dies in einem wissenschaftlichen Werk geschieht. Es macht den Eindruck, dass das Zürcher Obergericht willkürlich bestimmte legitime Zwecke, die dem Gericht sympathisch sind, gegenüber anderen legitimen Zwecken privilegiert. Dass Verfahrenskritik vom Zürcher Obergericht missbilligt wird, zeigt eine Passage auf S. 52 des Urteils, wo es bei der Wiedergabe des Prozessberichts Xaver März heisst, leicht zu erkennen sei zudem, dass der Verfasser zu den Sympathisanten der Verurteilten gehöre, weil schon die erste Seite des Berichts die Behauptung enthalte, die Anklage gegen Graf und Förster stehe auf schwachen Füssen. Diese Passage ist völlig unverständlich. Es kann einem kritisch gesinnten Gerichtsberichterstatter doch nicht verboten sein, zu schreiben, die Anklage stehe auf schwachen Füssen.
Soweit Kessler eine Gerichtsverhandlung schilderte, um das nach seiner Meinung unfaire Verfahren zu kritisieren und zu begründen, warum die Norm des Art. 261bis abgeschafft werden sollte, verfolgte er genau gleich legitime Ziele wie jemand, der dasselbe tut, um das Verhalten des Täters als abschreckendes Beispiel zu etikettieren oder wie ein Hochschulprofessor, der eine juristische Abhandlung zum Thema schreibt.
6. Auf den Missbrauch könnte allenfalls auch gestützt auf die Schwere der Beeinträchtigung der geschützten Rechtsgüter durch die Berichterstattung über eine Aussage oder ein Bild mit strafbarem Inhalt geschlossen werden. Niggli schlägt beispielsweise vor, dass bei der Wiedergabe pornographischer Bilder ein Missbrauch angenommen werden könnte, wenn es um harte Pornographie geht (N 647 ff.). Ich selber habe im Bereich von Art. 28 ZGB den hypothetischen Fall der Wiedergabe der heimlichen Aufnahme eines nackten Politikers in einer Sauna erwähnt, wenn dieses Bild Gegenstand einer Aufsehen erregenden Enthüllung oder eines Gerichtsverfahrens wäre, weil in diesem Fall eine grosse Diskrepanz zwischen der Schwere der Beeinträchtigung des Betroffenen einerseits und dem mit der Wiedergabe befriedigten öffentlichen Interesse bestünde (medialex 2005, S. 38). Das Zürcher Obergericht seinerseits erwähnte Inhalte, deren mediale Verbreitung mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung absolut verhindert werden müsse, so etwa Bilddarstellungen von sexuellen Handlungen mit Kindern oder Aufrufe zur Gewaltausübung (Urteil, S. 50). Es schloss auch die Rassendiskriminierung mit ein und führte aus, je schwerwiegender die eingeklagten Verstösse gegen das Verbot der Rassendiskriminierung oder auch der Kinderpornographie und die davon ausgehende Beeinträchtigung der betroffenen Menschen sei, desto grössere Zurückhaltung sei bei der Wiedergabe entsprechender Details geboten (Urteil, S. 49).
Der Vergleich einer Holocaustverharmlosung mit Kinderpornographie ist jedoch deplaziert. Die Holocaustlüge und die Holocaustverharmlosung ist im Unterschied zur harten Pornographie kein qualifizierter Tatbestand innerhalb der betreffenden Norm. Dies hat sinngemäss auch das Zürcher Obergericht eingesehen, wenn es schrieb, beim Tatbestand der Rassendiskriminierung möge das diesbezügliche Schutzbedürfnis etwas weniger ausgeprägt sein (Urteil, S. 50). Es führte sogar aus, der Umfang der rassendiskiminierenden Texte sei im Verhältnis zum Gesamtumfang der Homepage, auf der sie veröffentlicht wurde, verschwindend klein gewesen. Es sei daher nicht anzunehmen, dass sie ausserhalb des beschränkten Kreises der VgT-Anhänger grosse Beachtung fanden. Für die davon betroffene Religionsgemeinschaft der Juden sei keine so starke Beeinträchtigung entstanden, dass die Berichterstattung über Grafs Prozess unter Einschluss der dort gefallenen rassendiskiminierenden Äusserungen schon deswegen als missbräuchlich erscheinen müsste (Urteil, S. 52).
Solche Überlegungen beendete das Gericht jedoch wiederum mit einer überraschenden Antithese, indem es ausführte, bei krass diskriminierenden Äusserungen sei zumindest insofern grösste Zurückhaltung geboten, als solche auch im Rahmen der Gerichtsberichterstattung nur wiedergegeben werden dürften, soweit dies für das Verständnis des Prozessgeschehens unumgänglich sei. Diese Gegenthese wurde aber im nächsten Satz wiederum in der Gegenrichtung relativiert, indem geschrieben steht, bei der Frage, wieweit das Informationsbedürfnis im konkreten Fall reiche, müsse den Medienschaffenden unter dem Gesichtspunkt der Pressefreiheit und der Rechtssicherheit (sic!) ein grosser Spielraum zugestanden werden (Urteil, S. 50).
Schliesslich nahm das Obergericht einen schweren Verstoss an, nicht weil die Wiedergabe einer schweren Beeinträchtigung der Juden gleichgekommen sei, sondern weil der Inhalt der eingeklagten Textstellen in krasser Weise gegen Art. 261bis StGB verstosse (Urteil, S. 52 f.). Wenn man jedoch schon annehmen sollte, Kessler habe durch die Wiedergabe der betreffenden Aussagen Art. 261bis StGB verletzt, könnte doch einzig massgebend sein, ob diese Weiterverbreitung durch Kessler schwerwiegend wäre und nicht die offensichtliche Unwahrheit der Aussagen.
Auch bei solchen diffusen und widersprüchlichen Floskeln ist völlig unklar, was Kessler hätte tun müssen, um aus der Sicht des Zürcher Obergerichts noch innerhalb der Legalität zu bleiben. Die Rechtssicherheit, die das Zürcher Obergericht in diesem Zusammenhang bemüht, wird geradezu mit Füssen getreten.
7. Unklar blieb das Obergericht auch in Bezug auf die Frage, wieweit die rassendiskiminierenden Äusserungen "unkommentiert" wiedergegeben wurden bzw. wiedergegeben werden dürfen. Es führte wie bereits dargelegt (vgl. vorne II Ziff. 4) aus, der Tatbestand des Art. 261bis Abs. 2 und 4 sei erfüllt, wenn jemand solche Texte – zwar mit der Anmerkung, sie entsprächen nicht seiner Auffassung – unkommentiert veröffentliche, weil er in Kauf nehme, die strafbare Aussage weiterzuverbreiten und möglicherweise in ihrer Wirkung zu verstärken (Urteil, S. 48).
Auch auf S. 53 kritisierte das Zürcher Obergericht die seitenlange und fast durchwegs unkommentierte Veröffentlichung "revisionistischer" Behauptungen von Graf.
Was meint das Zürcher Obergericht unter "unkommentiert"? Wie das Obergericht selber ausführte, hat Kessler ja vermerkt, was das Ziel der Urteilspublikation war. Er habe wie erwähnt (vgl. vorne II Ziff. 4) gesagt, dass er keine Sympathie für den Nationalsozialismus hege und sich mit Grafs Äusserungen nicht identifizieren könne und dessen Geschichtsauffassung nicht teile, aber für das Recht auf freie Meinungsäusserung kämpfe. Das Obergericht wies speziell auf persönliche Anmerkungen von Kessler bei seinen Veröffentlichung hin, wonach es ihm um die laufende Unterschriftensammlung für die Volksinitiative zur Abschaffung des Art. 261bis StGB ging, und dass der Prozess gegen Graf ein Verfahren gegen einen Andersdenkenden sei, der niemandem etwas zu Leide getan, sondern bloss eine von der offiziell staatlichen Gerichtsschreibung abweichende Meinung vertreten habe. Der Fall zeige auf, dass die Abschaffung des "Antirassismusmaulkorbgesetzes" notwendig sei. Mit den sog. "Holocaustleugnern" verbinde ihn einzig das gemeinsame Schicksal der politischen Verfolgung etc. Kessler hat somit seine Publikation kommentiert. Falls das Obergericht mit Konkretisierung eine Distanzierung meinte, ist bereits ausgeführt worden, dass nach den in der Literatur vertretenen Auffassungen ein solches Erfordernis nicht aufgestellt werden kann (vgl. vorne I Ziff. 2). Schliesslich steht der Vorwurf in direktem Gegensatz zum Jersild-Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, in dem es gerade um unkommentierte rassistische Aussagen einer Jugendgruppe ging, die den grössten Teil einer Sendung ausmachten.
8. Widersprüchlich sind schliesslich auch die Aussagen des Obergerichts zum Umfang der wiedergegebenen Äusserungen.
Zunächst führte das Obergericht aus, unzulässig seien "Prozessberichte", die grösstenteils aus der detaillierten und kommentarlosen Wiederholung grob rassendiskriminierender Äusserungen bestünden (Urteil, S. 50). Dem kann man zustimmen. Doch trifft dieser Einwand auf den Fall Kessler gerade nicht zu. Wie erwähnt machen die in der Anklageschrift zitierten Passagen, und nur diese können beim folgenden Vergleich massgebend sein, weniger als 10% des gesamten Umfangs der Berichterstattung aus (vgl. vorne I Ziff. 2).
Das Zürcher Obergericht erwähnte sogar, der Umfang der rassendiskiminierenden Texte sei im Verhältnis zum Gesamtumfang der Homepage, auf der sie veröffentlicht wurde, verschwindend klein gewesen (Urteil, S. 52)!
In der Folge findet man im Zusammenhang mit der Thematik des Umfangs der wiedergegebenen Äusserungen weitere Kessler-günstige Passagen. So führte das Gericht aus, Medienleuten sei bezüglich des Umfangs, in dem sie über Einzelheiten einer Straftat berichten, ein erheblicher Spielraum zuzubilligen. Von Bedeutung sei sodann nicht nur, wie ausführlich die strafbaren Äusserungen wiedergegeben werden, sondern auch, wie viel Raum sie im Rahmen der in Frage stehenden Publikation einnehmen. Wenn sie dort in quantitativer Hinsicht dominieren, könne dies dem Berichterstatter nur angelastet werden, sofern er dieses Ungleichgewicht herbeigeführt habe. Wenn sich der Angeklagte in der fraglichen Gerichtsverhandlung sehr ausführlich äussere, so dürfe das auch im Medienbericht zum Ausdruck kommen. Von den Medien dürfe im Allgemeinen nicht verlangt werden, dass sie bei der Berichterstattung über ein Gerichtsverfahren die Vorbringen des Angeklagten in einem überproportionalen Mass kürzen (Urteil, S. 50).
Das Zürcher Obergericht attestierte Kessler ferner, dass er das Protokoll des Bezirksgerichts Baden, soweit es den Angeklagten Graf betraf, nahezu vollumfänglich wiedergab. Dass dabei dessen Ausführungen und diejenigen eines Entlastungszeugen den grössten Teils des Textumfanges ausmachten, habe daran gelegen, dass bezüglich der Parteivorträge fast nur die Verlesung und Einreichung von Protokollnotizen protokolliert worden war und nicht vom Angeklagten zu vertreten sei. Soweit Äusserungen des Staatsanwalts und des Gerichts protokolliert wurden, habe Kessler fast durchwegs auch diese veröffentlicht. Dann heisst es wörtlich: "Er (Kessler) wahrte somit trotz seiner scharfen Kritik an Grafs Verurteilung ein Minimum an Objektivität" (Urteil, S. 52).
Aber auch diese Aussagen werden andernorts in ihr Gegenteil verkehrt. Auf S. 52 f. des Urteils meinte das Zürcher Obergericht, die eingeklagten Textstellen nähmen im Rahmen des Prozessberichts, in dem sie publiziert wurden, eine dominierende Stellung ein (Urteil, S. 52 f.). Auch im Prozessbericht von Xaver März nähmen rassendiskriminierende Inhalte breiten Raum ein (Urteil, S. 52), obwohl, wie dargelegt, dieser Berichte 16 Textseiten umfasst und in der Anklageschrift lediglich 32 Zeilen davon kritisiert werden, rund 5% des 16-seitigen Dokuments. Auf S. 51 doppelte das Zürcher Obergericht wie erwähnt mit der Erklärung nach, wenn der Täter rassendiskriminierende Inhalte ins Zentrum seiner Ausführungen stelle, sei davon auszugehen, dass ihre Weiterverbreitung sein eigentliches Ziel sei. In solchen Fällen sei die Berufung auf Art. 27 Abs. 4 missbräuchlich, weil sie einzig dazu diene, Art. 261bis StGB zu umgehen (Urteil, S. 51).
Diese gänzlich widersprüchlichen Aussagen wurden im Urteil des Zürcher Obergerichts ebenfalls nicht thematisiert.
9. Auf S. 53 schliesslich führte das Zürcher Obergericht als Quintessenz seiner Aussagen aus, zum Zwecke der – zweifellos zulässigen – Kritik an Art. 261bis StGB, an der Handhabung dieser Strafbestimmung seitens der Gerichte oder an der Art, wie entsprechende Verfahren abgewickelt werden, sei die ausführliche Publikation der rassendiskriminierenden Texte, um die es im Strafprozess gegen Jürgen Graf gegangen sei, klarerweise weder nötig noch tauglich. Der Angeklagte könne sich hiefür nicht auf Art. 27 Abs. 4 StGB berufen.
Auch diese Schlussfolgerung steht im diametralen Gegensatz zu anderen zitierten Passagen. Bei einer Gesamtwürdigung des Vorgehens von Kessler ist klar erkennbar, dass es ihm darum ging, die Ambiance der ganzen Gerichtsverhandlung gegen Graf wiederzugeben und für seine politischen Ziele (Abschaffung von Art. 261bis StGB etc.) nutzbar zu machen und "auf das unfair geführte Verfahren hinzuweisen" (vgl. Urteil, S. 46). Warum dies für die politische Zielsetzung von Kessler, die man wie erwähnt teilen oder nicht teilen kann, "klarerweise weder nötig noch tauglich" war, ist schlicht nicht nachvollziehbar.
III. Schlussfolgerungen
1. Ich halte mich an die Schlussfolgerungen in meinem Hauptgutachten. Danach ist es grundsätzlich nicht verboten, im Rahmen der Berichterstattung über ein öffentlich interessierendes Ereignis Aussagen und Bilder wiederzugeben, die an sich strafbar sind. Dies ist bei verschiedenen Meinungsäusserungsdelikten (Ehrverletzung, unlauterer Wettbewerb, Pornografie, Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, Rassismusnorm) gang und gäbe.
2. Ausnahmsweise strafbar ist ein solches Verhalten nur in Fällen des Missbrauchs, namentlich wenn belegt ist, dass die Berichterstattungsform nur gewählt wurde, um das betreffende Gedankengut weiterzuverbreiten, bzw. wenn ein krasses Missverhältnis zwischen der Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts und dem wahrzunehmenden öffentlichen Interesse besteht.
3. Die mir vorliegenden Fakten im Fall Kessler sprechen nicht dafür, dass dieser die Publikation des Gerichtsprotokolls und des Berichts März benutzt hat, um eine Verharmlosung des Holocaust zu propagieren, sondern es ging ihm darum, nach seiner Meinung bestehende Missbräuche im Umgang mit der Rassismusnorm und des betreffenden Verfahrens zu dokumentieren. Kessler geht es insbesondere auch um die Abschaffung dieser Norm. Solche Aussagen sind durch die Meinungsäusserungsfreiheit und Art. 27 Abs. 4 StGB gedeckt.
4. Es ist letztlich unmöglich, sich in diesem Punkt mit dem Urteil des Zürcher Obergerichts vom 29.11.2004 seriös auseinanderzusetzen, weil es sich bei diesem Urteil um die reinste "Wundertüte" handelt, um eine Ansammlung widersprüchlicher Aussagen, die zu einem grösseren Teil für einen Freispruch von Kessler sprechen und zu einem kleineren Teil dagegen, ohne dass diese Widersprüche aufgeklärt werden.
Das Zürcher Obergericht hütet sich ferner, sich mit der bestehenden zugunsten von Kessler sprechenden Literatur auseinanderzusetzen, obwohl ihr diese in meinem Hauptgutachten gewissermassen auf dem Serviertablett präsentiert wurde.
Der wichtige Jersild-Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der ebenfalls für Kessler spricht wird ein einziges Mal zitiert, und erst noch falsch, d.h. als angeblicher Beleg für die Zulässigkeit von Wiedergaben rassendiskriminierender Aussagen in rechtswissenschaftlichen Publikationen (Urteil S. 51).
Wenn das Urteil des Zürcher Obergerichts so stehen bleibt, würde dies ferner zu einer aus der Sicht der Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit unerträglichen Verunsicherung führen, weil unklar ist, wie es Kessler ganz konkret hätte machen müssen, um aus der Sicht des Zürcher Obergerichts in der Legalität zu bleiben. Die Rechtsunsicherheit würde aber auch in allen anderen Fällen bestehen, bei denen es bisher vorgekommen ist, dass über Aussagen und Bilder mit strafbarem Inhalt berichtet wurde. Wie wäre es z.B. im Fahrner-Fall? Wäre es in Bezug auf den Straftatbestand der Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit zulässig, ein Bild mit einem gekreuzigten Schwein wiederzugeben, wenn es Gegenstand eines Prozesses war, nicht aber ein Bild mit einer gekreuzigten nackten Frau mit gespreizten Beinen? Oder wie wäre es in einem Ehrverletzungsprozess? Dürfte man berichten, Gegenstand des Prozesses sei der Vorwurf der Lüge, hingegen nicht, der Kläger sei als Nazi beschimpft worden? Man muss beachten, dass es sich bei der Rassendiskriminierung lediglich um ein Vergehen handelt und dieser Tatbestand keine andere Behandlung verdient als andere Gedankenäusserungsdelikte. Das Urteil des Zürcher Obergerichts würde in all diesen Fällen eine grosse Rechtsunsicherheit hinterlassen.
Im Strafrecht gilt ferner das Bestimmtheitsgebot. Normen müssen das verpönte Verhalten so klar umschreiben, dass dem Betroffenen klar wird, was verboten ist und was nicht. Zwar gilt Art. 1 StGB nicht unmittelbar für die einschränkende Interpretation einer Norm, doch verlangen Sinn und Geist des Bestimmtheitsgebots, dass bei solchen Interpretationen Kriterien massgebend sind, die verallgemeinert werden können und klare Grenzziehungen erlauben. Mit diesem Anliegen steht das Urteil des Zürcher Obergerichts leider auf Kriegsfuss.
Franz Riklin
5.2
Die Verurteilung des Angeklagten durch die Vorinstanz impliziert, dass der Angeklagte - ein juristischer Laie - hinter dem bis dato völlig unbestrittenen, klaren Wortlaut von StGB 27 einen versteckten Vorbehalt im Sinne der vorinstanzlichen Begründung hätte erkennen müssen, obwohl diesen Vorbehalt nicht einmal die führenden Juristen in diesem Land, heute, nach einer kontroversen Fachdiskussion darüber, erkennen können bzw sich darüber völlig uneinig sind. Namentlich der renommierte, auf Medienrecht spezialisierte Freiburger Prof Franz Riklin kann die Auffassung des Obergerichtes nicht teilen und vertritt klar die Ansicht, dass sich der Angeklagte nicht rechtswidrig verhalten habe (Ziffer 5.1).
5.3
Die angebliche Rechtswidrdigkeit der inkriminierten Veröffentlichung war für den Angeklagten aufgrund des klaren Wortlautes von StGB 27.2 unmöglich voraussehbar, weshalb er vor der ersten Instanz wegen Rechtsirrtum freigesprochen wurde. Die Verurteilung durch das Obergericht verletzt ganz klar das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot und die Meinungsäusserungs- und Medienfreiheit (EMRK 6 und 10), wie auch Prof Riklin im Gutachten festhält.
5.4
Die Vorinstanz behauptet, der Angeklagte habe - obwohl er Zweifel an der Zulässigkeit dieser Veröffentlichung gehabt habe - sich nicht bei einem Anwalt erkundigt (Seite 54f). Diese Behauptung ist unwahr, eine reine Erfindung der Vorinstanz und damit eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung bzw willkürliche Beweiswürdigung, die zudem urteilsentscheidend war. Der Angeklagte hat sich sehr wohl bei Anwälten erkundigt, unter anderen bei Rechtsanwalt Rodolpho Spar, Postfach 564, 8035 Zürich. Dabei wurde ihm gesagt, dass hier nicht die Rassendiskriminierungs-Strafnorm massgebend sei, sondern Artikel 27 StGB, welcher eine wahrheitsgetreue Berichterstattung ausdrücklich erlaube. Damals bestanden unter Juristen und in der juristischen Fachliteratur noch nicht die geringsten Zweifel daran. Der umstrittene BGE erschien erst später.
5.5
In grotesker Weise dreht die Vorinstanz dem Angeklagten daraus einen Strick, dass er sich vor der Veröffentlichung pflichtbewusst um die Abklärung einer allfälligen Strafbarkeit bemühte und erst veröffentlichte, nachdem er nichts dem klaren Wortlaut von StGB 27 Widersprechendes gefunden hatte. Eine solche Unrechtsprechung ist typisch für politische Justiz, bei der es nicht um Recht und Gesetz, sondern um die Zermürbung und Terrorisierunge von unbequemen, kritischen Bürgern geht.
5.6
Der BF wurde verurteilt, weil er den unbestritten wahrheitsgemässen Bericht von Xaver Merz über die Gerichtsverhandlung gegen Graf veröffentlichte.
Gemäss Presserecht ist nur der Autor verantwortlich. Der Autor ist bekannt. Sämtliche Vorinstanzen haben sich absolut nicht mit dem Autor befasst, absolut keine Anstrengung unternommen, diesen zu Verantwortung zu ziehen und die presserechtliche Kaskadenhaftung mit keinem Wort erwähnt. Das stellt eine bundesrechtswidrige, willkürlicher Anwendung bzw Nichtanwendung von Bundesrecht dar.
5.7
Hätte sich der Angeklagte als verantwortlicher Redaktor geweigert, den Autor bekannt zu geben - was jedoch gerade nicht zutrifft -, wäre er deswegen, nämlich gemäss StGB 322bis, anzuklagen gewesen, nicht wegen Rassendiskriminierung. Die diesbezügliche Verurteilung wegen Rassendiskriminierung stellt einen Eingriff in die Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit (EMRK 10) dar, der keine gesetzliche Grundlage hat und damit menschenrechtswidrig ist, und verletzt zudem das Redaktionsgeheimnis (BV 17.3).
5.8
Erstmals im vorinstanzlichen Urteil (Seite 53) wurde dem BF vorgehalten, er habe sich deshalb strafbar gemacht, weil es nicht notwendig gewesen sei, im Bericht über die Gerichtsverhandlung alle verhandelten inkriminierten Äusserungen Grafs zu erwähnen. Die Verteidigung erhielt keine Möglichkeit, sich dazu zu äussern - obwohl die Verurteilung einzig und allein auf diesem neuen Vorhalt basiert. Damit wurde das rechtliche Gehör in schwerwiegender Weise verletzt.
5.9
Diese neue Auslegung von StGB 27.2 konnte weder der Autor noch der BF als verantwortlicher Redaktor wissen und voraussehen und ist sogar für Juristen völlig neu. Weder den beiden Verteidigern noch dem spezialisierten Medienstrafrechtsprofessor war dies bis anhin bekannt (Ziffer 5.1). Damit verletzt das vorinstanzliche Urteil in krasser Weise das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot (EMRK 6). StGB 27 wurde nicht verfassungs- und EMRK-konform angewendet.
5.10
Der BF hat das Gerichtsprotokoll in Bezug auf Jürgen Graf wahrheits- und wortgetreu wiedergegeben, also genau das - nicht weniger und nicht mehr - verbreitet, als was die Öffentlichkeit an jener uneingeschränkt öffentlichen Gerichtsverhandlung zu hören bekam. Dass dies nicht durch StGB 27 geschützt sein soll, kann dem klaren Gesetzestext nicht entnommen werden und widerspricht auch ganz klar dem Öffentlichkeitsgebot gemäss EMRK 6.
5.11
Bundesrichter Wiprächtiger beschrieb in einem Aufsatz in media-lex 1/04 Sinn und Bedeutung der Gerichtsöffentlichkeit wie folgt:
Das Bundesgericht bezeichnet öffentliche Verhandlungen vor Gerichten unter dem Gesichtswinkel von Art 6 Ziff 1 EMRK als öffentlich zugängliche Informationsquelle der Allgemeinheit und der Journalisten...
Die Gerichtsbarkeit stellt sich öffentlicher Beobachtung und Auseinandersetzung. Dies erlaubt es der Bevölkerung, sich an konkreten Beispielfällen über die Rechtsdurchsetzung zu informieren; die Justiz wird der Kritik zugänglich. Für Allgemeinheit ist die Gerichtsöffentlichkeit ein wichtiges Mittel, um über die wirksame und angemessene Erfüllung der Richteraufgabe zu wachen...
Die Öffentlichkeit kann ihre notwendige Kontrolle über das staatliche Handeln, dh auch über die Justiz, nur dann wahrnehmen, wenn die Massenmedien als Vermittler auftreten...
Da nicht jedermann jederzeit an beliebigen Gerichtsverhandlungen teilnehmen kann, übernehmen die Medien mit ihrer Gerichtsberichterstattung insofern eine wichtige Brückenfunktion, als sie die richterliche Tätigkeit einem grösseren Publikum zugänglich machen...
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vertritt sinngemäss die gleiche Auffassung.
In der Nachtrags-Anklageschrift vom 8. August 2000, Seite 2, wurde dem BF genau das als strafbar vorgeworfen, was ausdrücklich - und durch Verfassung und EMRK geschützt - Aufgabe der Medien ist, nämlich für alle jene über öffentliche Gerichtsverhandlungen zu berichten, die daran nicht selber teilnehmen konnten:
Soweit es sich um die Wiederholung von Äusserungen handelt, die an einer Gerichtsverhandlung gemacht worden sind, so erreichten diese Ausführungen mit der Veröffentlichung im Internet einen weiteren Personenkreis als denjenigen, der an der Verhandlung anwesenden Zuschauer, womit diese Ausführungen einem erweiterten Zielpublikum von unbestimmt vielen Personen zugänglich gemacht wurde.
Die erste Instanz sah die Willkür und Haltlosigkeit dieses Vorhaltes offenbar ein und ersetzte ihn durch einen anderen: StGB 27.2 gelte nicht, wenn an einer öffentlichen Gerichtsverhandlung rassendiskriminierende Äusserungen verhandelt würden.
Prof Riklin hat in seinem Gutachten vom 24. August 2004 (bei den Akten), sowie in der Ergänzung zum Gutachten (Ziffer 5.1) ausführlich dargelegt, weshalb diese Auffassung unhaltbar ist, und das Obergericht hat sich dieser Auffassung angeschlossen. Aber anstatt den BF frei zu sprechen - was politisch nicht opportun schien - erfand das Obergericht seinerseits wieder einen neuen Vorhalt: der BF hätte das Gerichtsprotokoll kürzen müssen und nicht alle verhandelten Äusserungen Grafs wiedergeben dürfen; einige Beispiele hätten genügt.
Damit wurde der BF vor jeder Instanz mit einem anderen Vorhalt konfrontiert, was eine gezielte und wirksame Verteidigung verhinderte und damit die Garantien gemäss EMRK 6 verletzte. Indem der BF jeweils in der Urteilsbegründung mit neuen Vorhalten konfrontiert wurde, wurde insbesondere auch das rechtliche Gehör verletzt.
Die vorinstanzliche Auffassung, die Medien dürften nicht vollständig über alles informieren, was an einer öffentlichen Gerichtsverhandlung verhandelt wurde, läuft darauf hinaus, dass das mittelbar über die Medien informierte Publikum nicht die gleiche Informationsfreiheit habe wie die persönlich zur Verhandlung erscheinenden Zuhörer. Diese Beschneidung der Meinungsäusserungs-, Presse- und Informationsfreiheit entbehrt nicht nur einer gesetzlichen Grundlage, sie in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung offensichtlich auch nicht notwendig. Die Vorinstanz hat denn auch keine solche Notwendigkeit geltend gemacht und keine ernsthafte Interessenabwägung vorgenommen, wie das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ständiger Praxis bei Grundrechtseingriffen verlangt.
6. Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Nichtbegründung der Strafart
6.1
Für die der Verurteilung zugrunde liegenden Delikte ist die Strafandrohung gemäss StGB "Gefängnis oder Busse".
6.2
Die Vorinstanz hat nicht begründet, warum der BF zu Gefängnis und nicht zu einer Busse verurteilt worden ist.
6.3
Auch in der Anklageschrift und im erstinstanzlichen Urteil fehlt eine solche Begründung.
6.4
Die fehlende Begründung ist umso unverständlicher, als kurze Gefängnisstrafen in der Lehre einheitlich als sinnlos oder gar kontraproduktiv abgelehnt werden (anstelle vieler: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT II, Seite 71 ff) und der Gesetzgeber kurze Gefängnisstrafen zu Gunsten von Geldstrafen im Jahr 2002 abgeschafft hat. Diese Revision des StGB ist lediglich aus praktischen Gründen (Anpassung der kantonalen Gesetze) noch nicht in Kraft gesetzt worden.
6.5
Einer antizipierten Berücksichtigung der vom Gesetzgeber zugunsten von Geldstrafen abgeschafften kurzen Freiheitsstrafen steht das heute noch geltende Recht nicht entgegen. Warum der BF trotzdem zu 5-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, ist nicht nachvollziehbar, ja geradezu willkürlich. Umso unverständlicher ist das Fehlen jeglicher Begründung.
6.6
"Das heisst, dass die Wahl einer bestimmten Art von Strafe innerhalb des gesetzlichen Rahmens sehr viel eher rational begründet werden kann als die Festsetzung des der Schuld entsprechenden Masses." (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT II, Seite 251)
6.7
Die fehlende Begründung verunmöglicht es dem BF, sich mit den vom Gesetz vorgesehenen Rechtsmitteln wirksam gegen die Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe zu verteidigen. Damit ist die Begründungspflicht gemäss EMRK 6 verletzt.
6.8
Der Pächter eines landwirtschaftlichen Betriebes, dem die Pacht gekündigt worden war, warf den Vertreter der verpachtenden Stiftung in die Mistgrube und verschmierte sein Gesicht mit Mist. Das Opfer trug ein Schädeltrauma mit Hirnerschütterung davon. Der Täter erhielt zwei Wochen Gefängnis bedingt (Urteil des Bezirksgerichtes Münchwilen vom 14. Juni 2001)
Ebenfalls nur zwei Wochen bedingt erhielt ein Autofahrer, der eine betagte Frau auf dem Zebrastreifen zu Tode gefahren hatte. Er habe zwar eine grüne Jacke wahrgenommen. Dass diese grüne Jacke jedoch von einer betagten Frau getragen wurde, war seiner Aufmerksamkeit entgangen. (Urteil des Bezirksgerichtes Arbon vom 15. September 2002)
Demgegenüber wird der BF, der sich in Notwehr mit einem harmlosen Pfefferspray wehrte, mit Gefängnis unbedingt bestraft.
6.9
Die Vorinstanz hat willkürlich keine Strafmilderung durch achtenswerte Beweggründe (StGB 64, Stratenwerth AT II Seite 256, 257) in Betracht gezogen (Seite 71, 1.a), obwohl sie die tierschützerische Motivation des BF anerkennt (Seite 58 unten). In dem die Vorinstanz den Verzicht auf Strafmilderung mit keinem Wort begründete, wurde die Begründungspflicht verletzt. Der BF ist deshalb nicht in der Lage zu den Beweggründen der Vorinstanz Stellung zu nehmen, womit ihm auch im Nichtigkeitsverfahren eine wirksame Verteidigung verunmöglicht wird.
7. Willkürliche Verweigerung des bedingten Strafaufschubes
Am 30. September 2004 erschien im Tages-Anzeiger unter dem Titel "Ich wollte ihn nicht gross verletzen, oder so" ein Bericht über die Verurteilung eines 19 Jahre alten Kroaten zu einer bedingten Gefängnisstrafe (Beilage 8). Einfach so schlug dieser einem 16-jährigen Schweizer die Faust ins Gesicht und zeigte sich im Nachhinein weder reumütig noch einsichtig.
Dem nicht gewalttätigen BF hingegen wurde der bedingte Strafaufschub bezüglich des angeblichen Notwehrexzesses willkürlich und ohne Begründung verweigert.
Während Gewalttätige in willkürlicher Weise Milde erfahren, werden politisch Verfolgte in der Schweiz härter angefasst und mit Justizwillkür terrorisiert.
Jeder andere Angeklagte wäre im vorliegenden Fall bezüglich Körperverletzung freigesprochen worden, da erwiesenermassen und vom Obergericht zugestanden eine Notwehrsituation vorlag und das mildeste mögliche Mittel eingesetzt wurde, nämlich ein Pfefferspray, der extra für solche Fälle konzipiert ist und so beschaffen ist, dass nur vorübergehend die Sicht getrübt und damit weitere Angriffe erschwert werden, jedoch keine bleibenden Schäden entstehen.
Jedem anderen Angeklagten wäre, falls er dennoch wegen Notwehrexzess verurteilt worden wäre, der bedingte Strafaufschub gewährt worden - in willkürlicher Weise nicht jedoch dem BF, obwohl der BF nicht wegen Gewalttätigkeit vorbestraft und auch sonst nicht als gewalttätig bekannt ist und keine objektiven Indizien vorliegen, der BF sei diesbezüglich unverbesserlich. Der BF ist nicht uneinsichtig sondern - so wie auch seine Verteidiger - lediglich der Auffassung, dass eine berechtigte Notwehr vorliege.
Die Vorinstanz hat nicht begründet (Verletzung der Begründungspflicht bzw des rechtlichen Gehörs), weshalb für den auf den Notwehrexzess entfallenden Anteil der ausgesprochenen Gefängnisstrafe nicht der bedingte Strafaufschub gewährt wurde.Die Vorinstanz hat keine gesetzlichen Vorschriften genannt, welche dies verbieten würde. Das Urteil ist in diesem Punkt absolut stossend und willkürlich.
8. Vorverurteilung
An der Berufungsverhandlung vor Vorinstanz stellte die amtliche Verteidigerin folgenden Antrag:
In vorliegenden Verfahren ist der Angeschuldigte schon vor Eröffnung der Strafuntersuchung in menschenrechtswidriger Weise vorverurteilt worden. Ich beantrage, dass dies im Urteil festgestellt wird und ihm eine angemessene Genugtuung zugesprochen wird. Ein anderes Rechtsmittel stand dem Angeschuldigten nicht zur Verfügung.
Begründung:
Die Unschuldsvermutung gemäss EMRK Artikel 6 Absatz 2 lautet: "Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist."
Die Unschuldsvermutung ist eine Verfahrensregel. Eine Vorverurteilung im Untersuchungsverfahren verletzt daher die Unschuldsvermutung unabhängig davon, ob es schlussendlich zu einem Freispruch oder zu einer Verurteilung kommt. Dementsprechend ist auch der Antrag auf Feststellung unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in der Sache selbst.
Das vorliegende Verfahren begann im Jahr 1998 mit einer anonymen Anzeige eines Unbekannten an das Bundesamt für Polizeiwesen. Diese wurde an das Bezirksamt Münchwilen weitergeleitet. Das Bezirksamt Münchwilen trat auf die Anzeige wegen offensichtlicher Haltlosigkeit nicht ein. Auf eine entsprechende Wühlarbeit von zwei jüdischen Journalisten des Sonntags-Blicks wurde der Angeschuldigte dann vom Thurgauer Staatsanwalt Riquet Heller massiv vorverurteilt. Im Sonntags-Blick vom 6.12.1998 (bei den Akten) wurde dieser Staatsanwalt wie folgt zitiert:
"Die zuständige Behörde in Münchwilen TG weigerte sich anfangs, gegen Kessler zu ermitteln. Erst als die Bundespolizei bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft protestierte, kam die Strafuntersuchung in Gang. Der Thurgauer Staatsanwalt Riquet Heller bestätigt: "Wir haben das Bezirksamt Münchwilen unmissverständlich angewiesen, eine Untersuchung gegen Kessler einzuleiten. Die nötigen polizeilichen Ermittlungen sind inzwischen angelaufen." Kessler selbst weiss nach eigenen Angaben noch nichts von der Anzeige. ... Im Fall Kessler wird jetzt auch der im Aargau lokalisierte Internet-Provider zur Verantwortung gezogen, der Kesslers Texte verbreitet. Staatsanwalt Heller begründet: 'Das Loch im Tank, aus dem die stinkige Flüssigkeit fliesst, soll gestopft werden.'"
Das ist eine krasse, vorbehaltlose Vorverurteilung betr angeblichem Rassismus. Der dadurch eingeschüchterte Interne-Provider sperrte daraufhin umgehend die Homepage des VgT.
Die Zürcher Strafprozessordnung enthält keine Regelungen, wie solche Menschenrechtswidrigkeiten im Laufe eines Strafverfahrens zu behandeln sind. Gemäss EMRK hat der Angeschuldigte jedenfalls einen Anspruch auf Feststellung und Entschädigung. Sollte das Gericht diesem Anspruch nicht nachkommen, so wird es halt später der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte tun müssen.
Die Vorinstanz hat dieses Feststellungsbegehren in menschenrechts- und damit auch bundesrechtswidriger Weise abgelehnt unter Missachtung eines präjudiziellen Entscheides des Kassationsgerichtes vom 3.12.1990 (SJZ, 1992, Heft 5, Seite 89). Dieser Entscheid wurde ohne jede Begründung und damit willkürlich übergangen, obwohl er genau auf vorligenden Sachverhalt zutrifft. Das Kassationsgericht hat darin festgehalten, dass - gestützt auf die EMRK - ein Recht auf Feststellung von in der Untersuchung vorgekommenen Menschenrechtsverletzungen, die sich nicht auf das Urteil ausgewirkt haben, besteht und dass dies sowohl in den Erwägungen wie auch im Dispositiv festzuhalten ist.
Die Vorinstanz hat das Feststellungsbegehren mit der haltlosen Behauptung abgewiesen (Seite 40), mit der im Blick zitierten Äusserung des Thurgauer Staatsanwaltes habe dieser nur zum Ausdruck gebracht, dass er das inkriminierte Verhalten des Angeklagten für verwerflich halte; das stelle noch keine Vorverurteilung dar. Diese Begründung ist haltlos. Die Feststellung des Staatsanwaltes, "Das Loch im Tank, aus dem die stinkige Flüssigkeit fliesst, soll gestopft werden.", kann sprachlogisch-objektiv und subjektiv vom Durchschnittsleser nicht anders verstanden werden, als dass es darum gehe, ein feststehend rechtswidriges Verhalten mit den Mitteln der Strafjustiz zu stoppen. Diese Bedeutung ergibt sich schon rein logisch zwingen daraus, dass die Staatsanwaltschaft nicht beauftragt und nicht befugt ist, Verhaltensweisen mit den Mitteln der Strafjustiz zu stoppen, die nicht strafbar sind, sondern lediglich moralisch als verwerflich beurteilt werden, und dass die Staatsanwaltschaft ein Organ der Strafrechtspflege und nicht ein sonstiger Moralhüter ist.
Die haltlose, der Logik und dem gesunden Menschenverstand krass widersprechende vorinstanzliche Sachverhaltsbeurteilung stellt eine willkürliche Beweiswürdigung dar - ein absoluter Nichtigkeitsgrund. Sollte dies wider Erwarten nicht durch die nationalen Instanzen revidiert werden, wird der EGMR die Schweiz wegen Verletzung der Unschuldsvermutung verurteilen müssen.
9. Willkürliche, kompromittierende Darstellung der persönlichen Verhältnisse
Die Vorinstanz hat über die persönlichen Verhältnisse des BF unwahre und unnötig persönlichkeitsverletzende Feststellungen getroffen, indem auf Seite 72 unten festgehalten wird:
Sein steuerbares Vermögen überstieg 1999 eine Million Franken und hatte sich damit trotz der eher bescheidenen Einkommensverhältnisse innert drei Jahren verdoppelt.
Diese Feststellung ist unwahr: Weder überstieg das Vermögen des BF im Jahr 1999 noch zu irgend einem anderen Zeitpunkt eine Million Franken und sein Vermögen hat sich weder verdoppelt noch überhaupt zugenommen.
Diese unwahre Feststellung ist für den BF als Präsident einer gemeinnützigen Organisation kompromittierend, indem diese Feststellung den Verdacht auf eine deliktische oder zumindest ungehörige, unsaubere Bereicherung weckt, was offensichtlich auch der einzige Zweck dieser Feststellung war, denn für diese Feststellung gab es absolut keinen sachlichen Grund.
Die Feststellung war - auch wenn sie wahr wäre - in dieser Form im Rahmen der Urteilsbegründung nicht nötig. Ob sich das Vermögen des BF innert drei Jahren verdoppelt hat, war weder für die Schuldfrage noch für das Strafmass von Bedeutung. Auch wenn das Urteil auf Busse statt auf Gefängnis gelautet hätte, wäre es unerheblich, ob sich das Vermögen des BF innert drei Jahren verdoppelt hat oder nicht; für die Zumessung einer Busse wären einzig die aktuellen Vermögens- und Einkommensverhältnisse massgebend. Der BF ist jedoch zu Gefängnis, nicht zu einer Busse verurteilt worden, weshalb seine finanziellen Verhältnisse erst recht belanglos waren.
Es ist zwar richtig, dass der BF vor Vorinstanz keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen gemacht hat, was die Vorinstanz indessen nicht berechtigt, willkürliche, unwahre und kompromittierende Feststellungen darüber zu treffen.
Die Vorinstanz hat ihre willkürliche Feststellung offenbar aufgrund von Steuerunterlagen getroffen, aus denen ganz klar hervorgeht, dass darin nicht nur das Vermögen des BF, sondern auch das seiner Ehefrau, aufgeführt ist. Erhöht hat sich lediglich das Vermögen seiner Frau, mit welcher der BF in Gütertrennung lebt, und zwar zufolge einer Erbschaft, die korrekt deklariert und versteuert worden ist, was die Vorinstanz leicht hätte feststellen können, bzw müssen, bevor sie dubiose Feststellungen trifft und damit haltlose Verdächtigungen in Umlauf bringt.
Es ist haarsträubend, wenn ein Gericht billiger als der billigste Blick-Journalist aus Unterlagen, welche keinen klaren Aufschluss geben, willkürlich unwahre Feststellungen ableitet und diese auch völlig unnötigerweise so formuliert, dass sie beim unbefangenen Leser eine kompromittierende, rufschädigende und existenzgefährdende Wirkung hinterlassen.
Diese unwahre, kompromittierende Feststellung hat die Vorinstanz grobfahrlässig gemacht und damit das Willkürverbot (BV 9) und auch EMRK 8 verletzt, indem der Staat hierdurch in ungerechtfertigter Weise in das Privatleben des BF eingegriffen hat.
Die Feststellung ist auch aktenwidrig, da die Vorinstanz offensichtlich einen Steuerausweis beider Ehegatten als solchen nur des BF genommen hat (offensichtlicher Irrtum, dazu: Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, N 1074).
Dieser Mangel kann nicht auf andere Weise als durch Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und Rückweisung an die Vorinstanz zur Berichtigung behoben werden. Insbesondere genügt eine entsprechende Feststellung im Kassationsurteil allein nicht. Der Mangel bleibt bestehen, solange die kompromittierende Feststellung weiterhin im rechtskräftigen und damit für die Öffentlichkeit massgebenden Urteil steht.
Da der BF keine Gelegenheit erhielt, sich dazu zu äussern, wurde auch das rechtliche Gehör verletzt.
Dieses willkürliche, menschenrechtswidrige Verhalten der Vorinstanz wird nicht dadurch entschuldigt, dass der BF keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machte. Aus dem Schweigen eines Betroffenen willkürlich irgend etwas abzuleiten, können sich nicht einmal Boulevard-Journalisten ungestraft leisten - nur Oberrichter! Diese sind gemäs BGE 6S.768/1996 (Verein gegen Tierfabriken gegen Beat Gross, Stadtpolizei Bern), Erw 2 c, auch für unwahre, persönlichkeitsverletzende Äusserung durch die Amts- und Berufspflicht gegen zivil- und strafrechtliche Richtigstellungsbegehren geschützt.
Weil sich der BF gegen niemanden wehren kann, der Feststellungen aus einem rechtskräftigen Urteil weiterverbreitet, wäre der BF dieser perfiden Verleumdung schutzlos ausgeliefert, falls die Nichtigkeitsbeschwerde in diesem Punkt nicht gutgeheissen würde. Nicht einmal eine Gegendarstellung gegen entsprechende Presseveröffentlichungen wäre möglich, da eine solche unter Vorhalt des rechtskräftigen Urteils als "offensichtlich unwahr" abgelehnt werden könnte.
Ein solches hinterhältiges Rufmordsystem ist eines Rechtsstaates unwürdig und unterstreicht einmal mehr, wie die Justiz als Mittel der Politik gegen Regimekritiker eingesetzt wird.
Dr Erwin Kessler, Präsident des Vereins gegen Tierfabriken Schweiz VgT
11. Beilagen
1 Beilage 9 zum Plädoyer vom 7. November 2001 (Anzeige vom 26. Juli 2000 und Nichtanhandnahmeverfügung vom 2. Oktober 2000)
2 Klage gegen Delamuraz vom Tisch, Thurgauer Zeitung vom 12.2.1997
3 Offener Brief an den Abt des Klosters Einsiedeln, am 25.2.1997 der BA Bülach zugestellt
4 Anzeige an die Bezirksanwaltschaft Bülach betr Werke von Goethe, Pestalozzi etc
5 Nichtanhandnahmeverfügung der Bezirksanwaltschaft Bülach vom 19. Juni 2000
6 Auszug aus der Sonntags-Zeitung vom 5. März 2000
7 Protokollauszug Ständerat zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität von NR Blocher
8 Bedingte Verurteilung eines kroatischen Schlägers, Tages-Anzeiger vom 30. September 2004
9 Bibliografie Manfred Kyber (http://manfred-kyber.de/bibliographie.html)
10 Schreiben des Israelitischen Gemeindebundes vom 21. Februar 2005
11 Gemeinsame Erklärung des islamischen Zentrums Bern und des VgT zum Schächten
12 Schächten mit Betäubung, Der Bund, 8.1.2005
13 Ergänzungsgutachten von Prof Riklin vom 3. März 2005
14 "Zur Berichterstattung über Aussagen und Bilder mit strafbarem Inhalt", Prof F Riklin, in Medialex 1/05